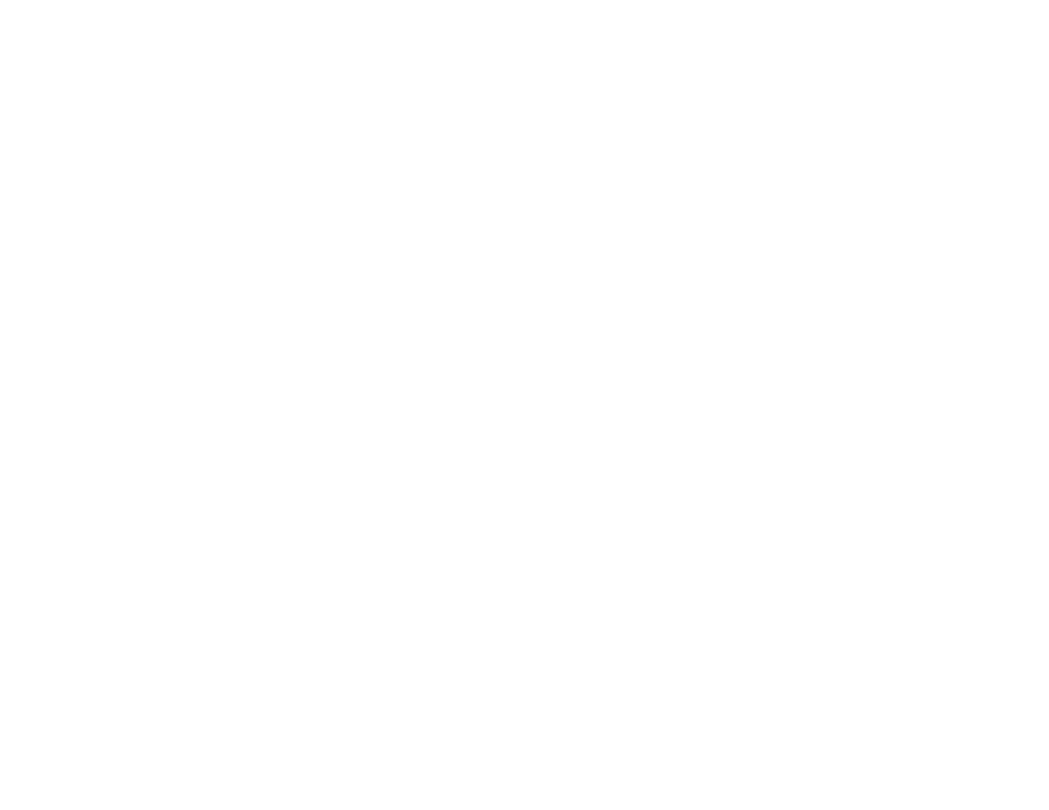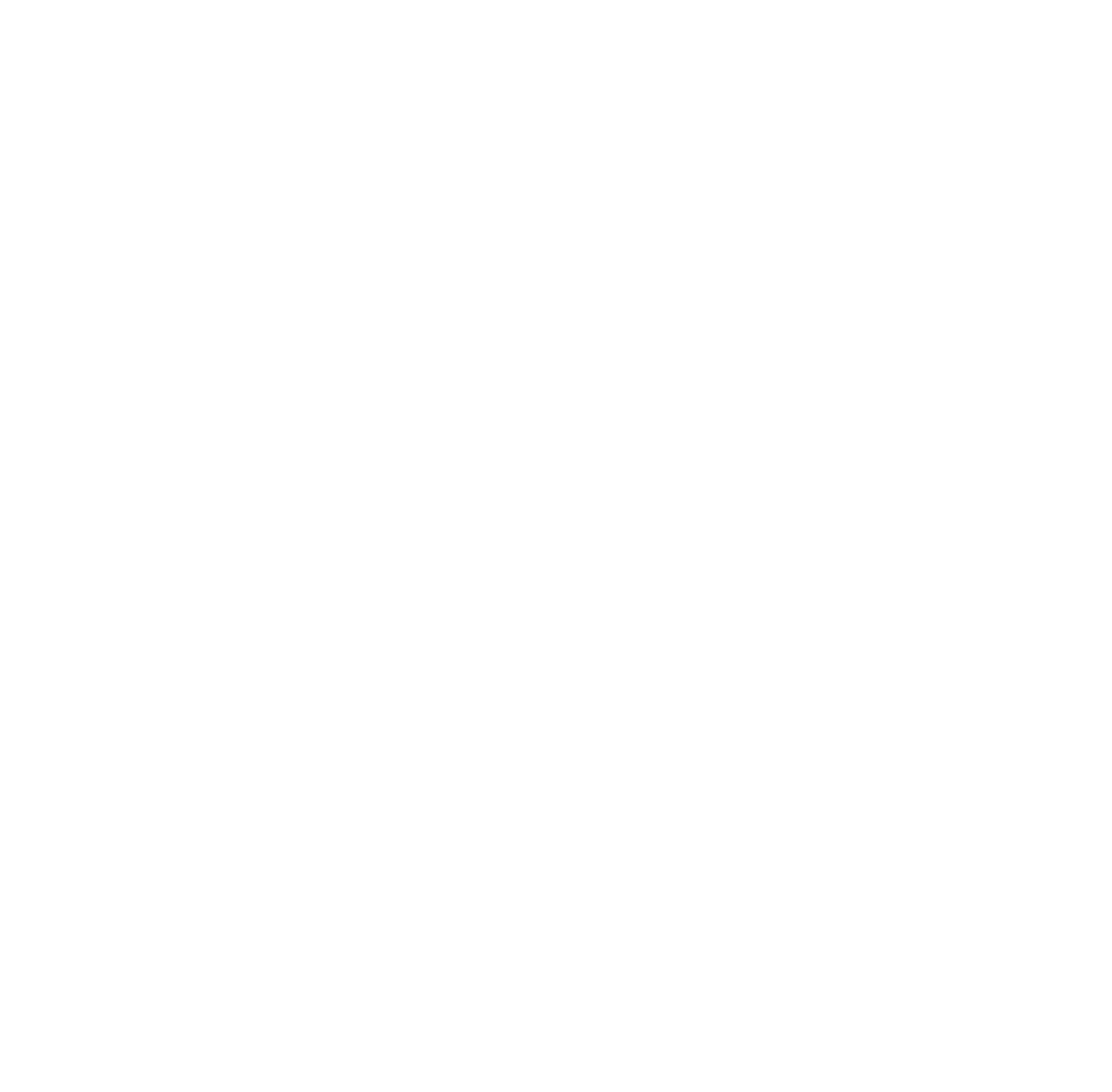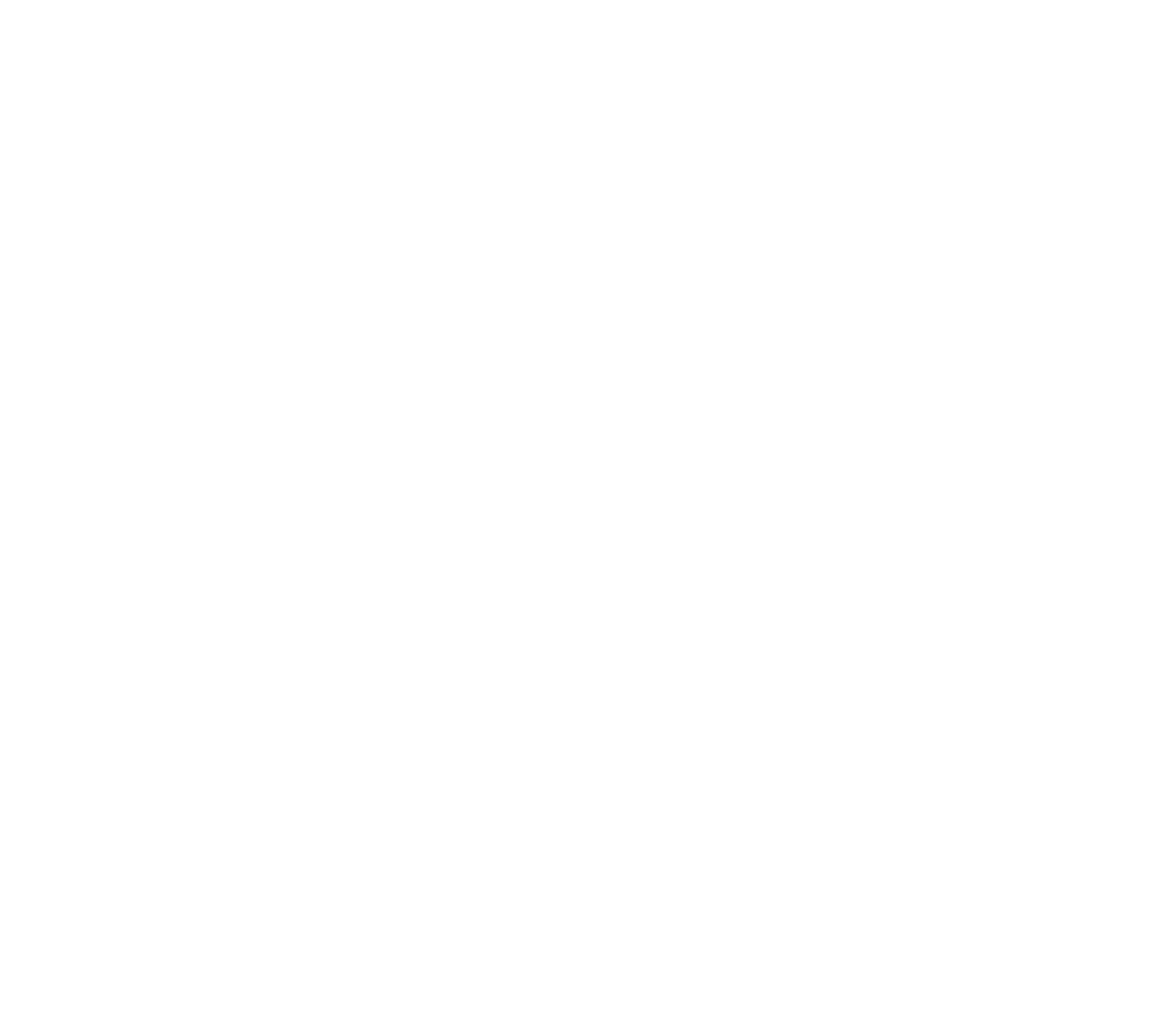© Monika Rittershaus
Wie Phönix aus der Asche
von Johanna Wall
Händels Werk Semele vereint das Beste aus italienischer Oper und englischem Oratorium. Lesen Sie, wie Händel der ursprünglichen Komödie Tiefe verlieh und sein Spiel mit musikalischen Formen die Handlung plastisch für Auge und Ohr vorführt.
Als Georg Friedrich Händel am 24. Februar 1711 mit Rinaldo seine erste Oper auf englischem Boden zur Uraufführung brachte, war dies derAuftakt zu einer neuen Ära. Die nächsten 40 Jahre sollte das britische Musiktheaterleben, in dem sich auch das politische Leben der Zeit spiegelte, maßgeblich von dem in Halle geborenen Komponisten geprägt werden. Das Musiktheater der Stunde – zumindest das der aristokratischen Upper class – hieß ab sofort »Opera seria«, und diese wurde grundsätzlich auf Italienisch gesungen.
Noch drei Jahre zuvor hatte der Komponist John Eccles eine englische Oper auf ein Libretto des Komödiendichters William Congreve angekündigt. Dessen um die Jahrhundertwende noch populäre Werke im Stil der »Restoration Comedy« trafen jedoch mit ihren frivolen Sujets und ihrem ironischem Witz bald nicht mehr den Zeitgeschmack. Eccles’ Oper wurde nie aufgeführt und landete 1710 zwischen den zwei Buchdeckeln der gesammelten Werke Congreves. Der Titel von Eccles’ geplanter »typisch britischer« Oper lautete: Semele.
Noch drei Jahre zuvor hatte der Komponist John Eccles eine englische Oper auf ein Libretto des Komödiendichters William Congreve angekündigt. Dessen um die Jahrhundertwende noch populäre Werke im Stil der »Restoration Comedy« trafen jedoch mit ihren frivolen Sujets und ihrem ironischem Witz bald nicht mehr den Zeitgeschmack. Eccles’ Oper wurde nie aufgeführt und landete 1710 zwischen den zwei Buchdeckeln der gesammelten Werke Congreves. Der Titel von Eccles’ geplanter »typisch britischer« Oper lautete: Semele.
Opulenz hoch zwei – die Opera seria
Ab dem frühen 18. Jahrhundert steuerte Händel die Geschicke des Opernwesens im britischen Königreich, zunächst als Leiter der ersten Royal Academy of Music, deren Stammhaus das Theater am Haymarket war. Als adeliges Aktienunternehmen unter königlicher Protektion ähnelte diese Unternehmung eher einer akademischen Operngesellschaft italienischen Zuschnitts, hielt aber faktisch das Opernmonopol und fungierte quasi als Hofoper. Die eigentliche Attraktion dieser Institution lag neben der exquisiten Musik, den spektakulären Ausstattungen, Kostümen und Bühneneffekten in den meist von Festlandeuropa, insbesondere Italien importierten Sängervirtuosen, allen voran den Kastraten, die wie Popstars gefeiert wurden. Das Publikum, bestehend aus Adeligen und internationalen Gästen, war finanziell potent.
Dennoch musste jede Aufführung aufgrund der hohen Unkosten ein Erfolg sein, sonst geriet die gesamte Unternehmung ins Wanken. Es überrascht also nicht, dass die erste Royal Academy nach knapp zehn Jahren vor dem finanziellen Ausstand.
Dennoch musste jede Aufführung aufgrund der hohen Unkosten ein Erfolg sein, sonst geriet die gesamte Unternehmung ins Wanken. Es überrascht also nicht, dass die erste Royal Academy nach knapp zehn Jahren vor dem finanziellen Ausstand.

© Monika Rittershaus
Musikalischer Bildersturm – das Operatorium
Nachdem Händel bereits mit Alexander’s Feast (1736), Saul (1738) und Israel in Egypt (1739) erfolgreich Werke auf englische Textvorlagen komponiert hatte, wandte er sich spätestens seit seinem großartigen Erfolg mit dem Messiah 1741 ganz dem Oratorium zu. Während die italienische Opera seria stark mit der höfischen Kultur verbunden war und weltliche Themen aus Mythologie oder Historie behandelte, in deren Zentrum einzelne Helden standen, um die sich die verworrensten Intrigen – mit entsprechend heftigen Gefühlsausbrüchen in Arienform – entspinnen ließen, prunkte das Oratorium nicht zuletzt mit opulenten Chören. Dem auch visuellen Pomp der Opernaufführungen italienischen Zu schnitts stand hier die reine Wucht der Musik gegenüber. Aufgeführt wurde – im Vergleich zur Oper kostengünstiger – konzertant und auf Englisch.
Bis 1744 hatte Händel bereits englische OdenDichtungen, die poetische Prosa der King’s Bible und britische Tragödien vertont. Nur noch ein dramatisches Genre fehlte ihm: die Komödie. Vielleicht war dies ein Grund, warum er sich für den bereits 40 Jahre alten Stoff aus der Feder Congreves entschied, jenes nie vertonte Opernlibretto, das vielleicht einmal am Anfang einer genuin britischen Operntradition hätte stehen können? Vielleicht hegte Händel sogar selbst entsprechende Ambitionen? Fakt ist: Semele zeigt in seiner Machart und Struktur ebenso viele Merkmale der italienischen Oper wie des englischen Oratoriums – und sollte gleichzeitig Händels letzte Auseinandersetzung mit der englischen Literatur bleiben.
Ist das jetzt eine Oper oder ein Oratorium?, fragten sich schon die Londoner, denen das Werk im Februar 1744 erstmals präsentiert wurde. Der mythologische, zudem ebenso deftige wie zum Teil komische Stoff, passte so gar nicht zum meist geistlichen oder zumindest seriösen Genre, geschweige denn zum spirituellen Gestus der gerade begonnenen Fastenzeit; dass das Werk in einer Konzertreihe und in englischer Sprache aufgeführt wurde, hingegen sehr. Und natürlich die großartigen Chöre, die in ihrer Anzahl und Fulminanz alles überstiegen, was seinerzeit auf Opernbühnen zu hören war. Das Intrigenspiel der göttlicharistokratischen Protagonisten mit ihren hochvirtuosen Arien wiederum – typisch Opera seria! Sujet und die Tatsache, dass das Werk auf ein Opernlibretto entstand, weisen ebenfalls stark in diese Richtung. Nicht von ungefähr erschien das Werk mit der Bezeichnung »after the manner of an oratorio«, also »nach Art eines Oratoriums«, was zumindest eine gewisse Diskrepanz zum sortenreinen Genre andeutet.
Bis 1744 hatte Händel bereits englische OdenDichtungen, die poetische Prosa der King’s Bible und britische Tragödien vertont. Nur noch ein dramatisches Genre fehlte ihm: die Komödie. Vielleicht war dies ein Grund, warum er sich für den bereits 40 Jahre alten Stoff aus der Feder Congreves entschied, jenes nie vertonte Opernlibretto, das vielleicht einmal am Anfang einer genuin britischen Operntradition hätte stehen können? Vielleicht hegte Händel sogar selbst entsprechende Ambitionen? Fakt ist: Semele zeigt in seiner Machart und Struktur ebenso viele Merkmale der italienischen Oper wie des englischen Oratoriums – und sollte gleichzeitig Händels letzte Auseinandersetzung mit der englischen Literatur bleiben.
Ist das jetzt eine Oper oder ein Oratorium?, fragten sich schon die Londoner, denen das Werk im Februar 1744 erstmals präsentiert wurde. Der mythologische, zudem ebenso deftige wie zum Teil komische Stoff, passte so gar nicht zum meist geistlichen oder zumindest seriösen Genre, geschweige denn zum spirituellen Gestus der gerade begonnenen Fastenzeit; dass das Werk in einer Konzertreihe und in englischer Sprache aufgeführt wurde, hingegen sehr. Und natürlich die großartigen Chöre, die in ihrer Anzahl und Fulminanz alles überstiegen, was seinerzeit auf Opernbühnen zu hören war. Das Intrigenspiel der göttlicharistokratischen Protagonisten mit ihren hochvirtuosen Arien wiederum – typisch Opera seria! Sujet und die Tatsache, dass das Werk auf ein Opernlibretto entstand, weisen ebenfalls stark in diese Richtung. Nicht von ungefähr erschien das Werk mit der Bezeichnung »after the manner of an oratorio«, also »nach Art eines Oratoriums«, was zumindest eine gewisse Diskrepanz zum sortenreinen Genre andeutet.
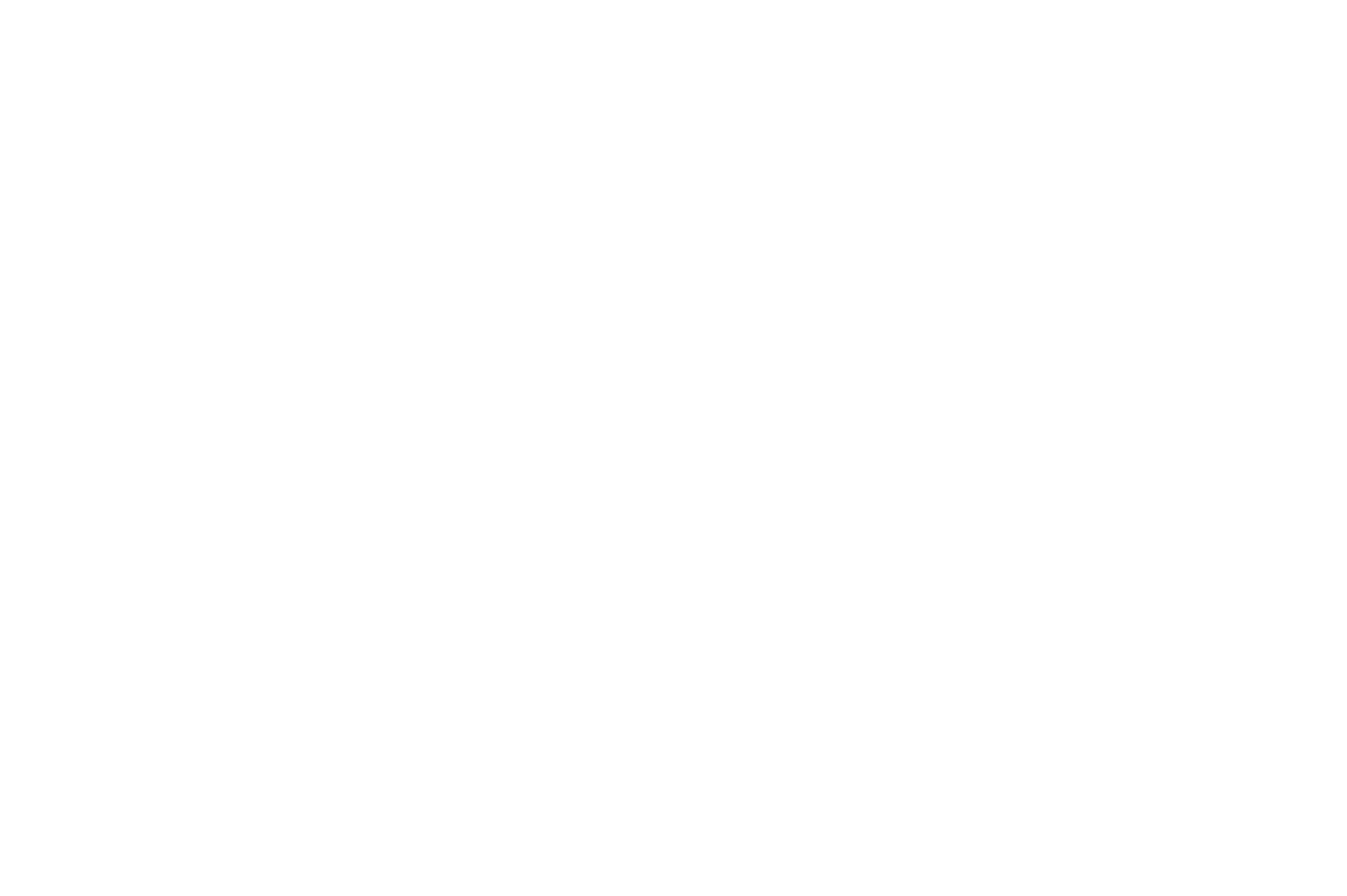
© Monika Rittershaus
Musikalisches Drama
Händel gelang es in Semele nicht nur in der Dramaturgie, sondern auch in der musikalischen Struktur, das Beste aus Oper und Oratorium zu vereinen. Wie im Oratorium sind die SeccoRezitative, in denen die Geschichte vorangetrieben wird, maximal kondensiert. Umso wichtiger ist es, den vollen Gehalt in den wenigen zur Verfügung stehenden Takten zu transportieren. Auch finden sich in Semele, anders als in der klassischen Opera seria, neben der DacapoArie diverse weitere Spielarten von Arien. Das mit etwas reichhaltigerer Instrumentalbesetzung begleitete AccompagnatoRezitativ markiert hier nicht mehr allein den Übergang von quasigesprochenem SeccoRezitativ zur gesungenen Arie, sondern wird zur eigenständigen musikalischen Form, in der Handlungsfortführung und emotionaler Ausdruck verschmelzen. Durch den virtuosen Gebrauch der einzelnen musikalischen Formen gelingt es Händel, den von Congreve eher holzschnittartig angelegten Komödientypen seelische Tiefe zu verleihen und die Handlung allein in der und durch die Musik dem Zuhörer plastisch vor Auge und Ohr zu führen.
Ein eindrucksvolles Beispiel für den, im wahrsten Sinne des Wortes, musikdramatischen Einsatz kompositorischer Mittel bietet das Quartett zwischen Semele, Athamas, Cadmus und Ino im ersten Akt. Die am Hochzeitstag ihrer Schwester vor unglücklicher Liebe zu Bräutigam Athamas schier vergehende Ino macht hier in einer stets abwärts gerichteten Melodielinie ihrem Kummer Luft, während der leicht genervte Brautvater sein Unverständnis für Inos schlechtes Timing in Sachen Befindlichkeitsäußerung chromatisch nach oben schraubt. Athamas und Semele fügen dem ihre (ratlosen) Kommentare hinzu. So entsteht aus den unterschiedlichen emotionalen und musikalischen Linien ein Moment, in dem die szenische Handlung sowohl maximal gebündelt als auch über einen einzelnen Moment hinaus gedehnt wird. Man könnte von einer Art schwingendem musikalischen »Freeze« sprechen.
Auch an anderer Stelle zeigt sich, wie die »Musik die Funktion der Bühne (übernimmt) und das Geschehen vor dem geistigen Auge des Zuschauers entstehen« lässt (Silke Leopold). So in der musikdramatischen FigurenEntwicklung des Göttervaters: Über weite Strecken sind Jupiter klassische DacapoArien zugedacht. Er ist gleichsam Inbegriff der göttlichen Ordnung, so wie die DacapoArie der Inbegriff der regelkonformen Arie ist. Doch Jupiter ist nicht nur Göttervater, sondern auch leidenschaftlicher Geliebter. Wenn er im dritten Akt vor Verlangen zu Semele schier platzt, verliert auch seine Arie an klassischer Contenance. Sein verzweifelter Versuch, Semele von ihrem fatalen Wunsch abzubringen, findet konsequenterweise gänzlich formlos statt. Das Bedauern über die Unabwendbarkeit von Semeles Schicksal dreht sich schließlich wie ein Gedankenkarussell der Hoffnungslosigkeit rondoartig zwischen Arie und Accompagnato und lässt in seiner Hilflosigkeit kaum jemanden im Publikum unberührt.
Ein eindrucksvolles Beispiel für den, im wahrsten Sinne des Wortes, musikdramatischen Einsatz kompositorischer Mittel bietet das Quartett zwischen Semele, Athamas, Cadmus und Ino im ersten Akt. Die am Hochzeitstag ihrer Schwester vor unglücklicher Liebe zu Bräutigam Athamas schier vergehende Ino macht hier in einer stets abwärts gerichteten Melodielinie ihrem Kummer Luft, während der leicht genervte Brautvater sein Unverständnis für Inos schlechtes Timing in Sachen Befindlichkeitsäußerung chromatisch nach oben schraubt. Athamas und Semele fügen dem ihre (ratlosen) Kommentare hinzu. So entsteht aus den unterschiedlichen emotionalen und musikalischen Linien ein Moment, in dem die szenische Handlung sowohl maximal gebündelt als auch über einen einzelnen Moment hinaus gedehnt wird. Man könnte von einer Art schwingendem musikalischen »Freeze« sprechen.
Auch an anderer Stelle zeigt sich, wie die »Musik die Funktion der Bühne (übernimmt) und das Geschehen vor dem geistigen Auge des Zuschauers entstehen« lässt (Silke Leopold). So in der musikdramatischen FigurenEntwicklung des Göttervaters: Über weite Strecken sind Jupiter klassische DacapoArien zugedacht. Er ist gleichsam Inbegriff der göttlichen Ordnung, so wie die DacapoArie der Inbegriff der regelkonformen Arie ist. Doch Jupiter ist nicht nur Göttervater, sondern auch leidenschaftlicher Geliebter. Wenn er im dritten Akt vor Verlangen zu Semele schier platzt, verliert auch seine Arie an klassischer Contenance. Sein verzweifelter Versuch, Semele von ihrem fatalen Wunsch abzubringen, findet konsequenterweise gänzlich formlos statt. Das Bedauern über die Unabwendbarkeit von Semeles Schicksal dreht sich schließlich wie ein Gedankenkarussell der Hoffnungslosigkeit rondoartig zwischen Arie und Accompagnato und lässt in seiner Hilflosigkeit kaum jemanden im Publikum unberührt.
Verwandlungen allerortens
Trotz der virtuosen Machart: Semele, ein Werk, das heute gerade in der englischsprachigen Welt große Popularität genießt, hatte es nach seiner Uraufführung zunächst schwer. Möglicherweise lag dies an der nicht klar zuordenbaren Natur des Werks, vielleicht aber auch an der Vorlage, die einem anderen Zeitgeist verpflichtet war – dem der britischen Restoration. Wie zu anderen restaurativen Epochen ging auch in der britischen Restaurationsepoche ein politisch reaktionärer Zeitgeist – in Form der Wiedererstarkung des Hauses Stuart – mit einem Ausbruch hedonistischer Lebensfreude einher. Das passende Unterhaltungsprogramm lieferte die sogenannte Restoration Comedy: intelligent, witzig und sexuell immens aufgeladen. Die Werke des in Irland aufgewachsenen Briten William Congreve (16791729) wurden u. a. von Henry Purcell als Opernvorlage genutzt. Nach der »Glorious Revo lution« von 1688 büßte der Stil, dem sich der enge Freund Jonathan Swifts Zeit seines Lebens verpflichtet fühlte, stark an Popularität ein.
Für Semele griff der Komödiendichter noch an der Schwelle zum 18. Jahrhundert auf eine zuverlässige Vorlage zurück: den Mythos der thebanischen Königstochter Semele, wie ihn Ovid um die Zeiten wende in seinen Metamorphosen festgehalten hatte. In diesen Verwand- lungen, der seit ihrer Entstehung wohl populärsten Mythensammlung, erzählt der Dichter im Rückgriff auf römische und griechische Sagen die Entstehung der Welt als einen Reigen menschlichgöttlicher
Transformationen. Aus den unterschiedlichsten Motivationen heraus – meist übermächtigen Emotionen wie Angst, Eifersucht, Einsamkeit oder auch Eitelkeit – werden menschliche Wesen durch göttliche Einwirkung in Tiere, Pflanzen, Steine oder auch Sternbilder verwandelt und letztere zu Symbolträgern der mit ihnen verbundenen mythischen Erzählungen. Auch Semele wird in gewisser Weise »transformiert«, denn sie verbrennt nicht nur zu einem Häuflein Asche, ihr Ende bedeutet zugleich auch die Geburt eines neuen Gottes. Davor jedoch steht keine rettende oder auch maßregelnde Verwandlung der Semele in etwas Drittes, sondern ihre brutale und totale Vernichtung.
Die erschaudernde und ehrfurchtgebietende Quintessenz der großen Parabel von Aufstieg und Fall der Sterblichen liefert der Chor: »Oh Schrecken und Entsetzen! Die Natur weist jedem seinen rechten Platz. Jenseits davon irr’n wir gleich Meteoren: Geschleudert durch die Leere zertrümmert uns ein harter Schlag, und unser eitles Feuer verliert sich im Rauch.« Spätestens hier zeigt sich das strikt hierarchische barocke Weltbild in seiner ganzen kalten Pracht. Doch dies ist nur der vorletzte Chor …
Für Semele griff der Komödiendichter noch an der Schwelle zum 18. Jahrhundert auf eine zuverlässige Vorlage zurück: den Mythos der thebanischen Königstochter Semele, wie ihn Ovid um die Zeiten wende in seinen Metamorphosen festgehalten hatte. In diesen Verwand- lungen, der seit ihrer Entstehung wohl populärsten Mythensammlung, erzählt der Dichter im Rückgriff auf römische und griechische Sagen die Entstehung der Welt als einen Reigen menschlichgöttlicher
Transformationen. Aus den unterschiedlichsten Motivationen heraus – meist übermächtigen Emotionen wie Angst, Eifersucht, Einsamkeit oder auch Eitelkeit – werden menschliche Wesen durch göttliche Einwirkung in Tiere, Pflanzen, Steine oder auch Sternbilder verwandelt und letztere zu Symbolträgern der mit ihnen verbundenen mythischen Erzählungen. Auch Semele wird in gewisser Weise »transformiert«, denn sie verbrennt nicht nur zu einem Häuflein Asche, ihr Ende bedeutet zugleich auch die Geburt eines neuen Gottes. Davor jedoch steht keine rettende oder auch maßregelnde Verwandlung der Semele in etwas Drittes, sondern ihre brutale und totale Vernichtung.
Die erschaudernde und ehrfurchtgebietende Quintessenz der großen Parabel von Aufstieg und Fall der Sterblichen liefert der Chor: »Oh Schrecken und Entsetzen! Die Natur weist jedem seinen rechten Platz. Jenseits davon irr’n wir gleich Meteoren: Geschleudert durch die Leere zertrümmert uns ein harter Schlag, und unser eitles Feuer verliert sich im Rauch.« Spätestens hier zeigt sich das strikt hierarchische barocke Weltbild in seiner ganzen kalten Pracht. Doch dies ist nur der vorletzte Chor …
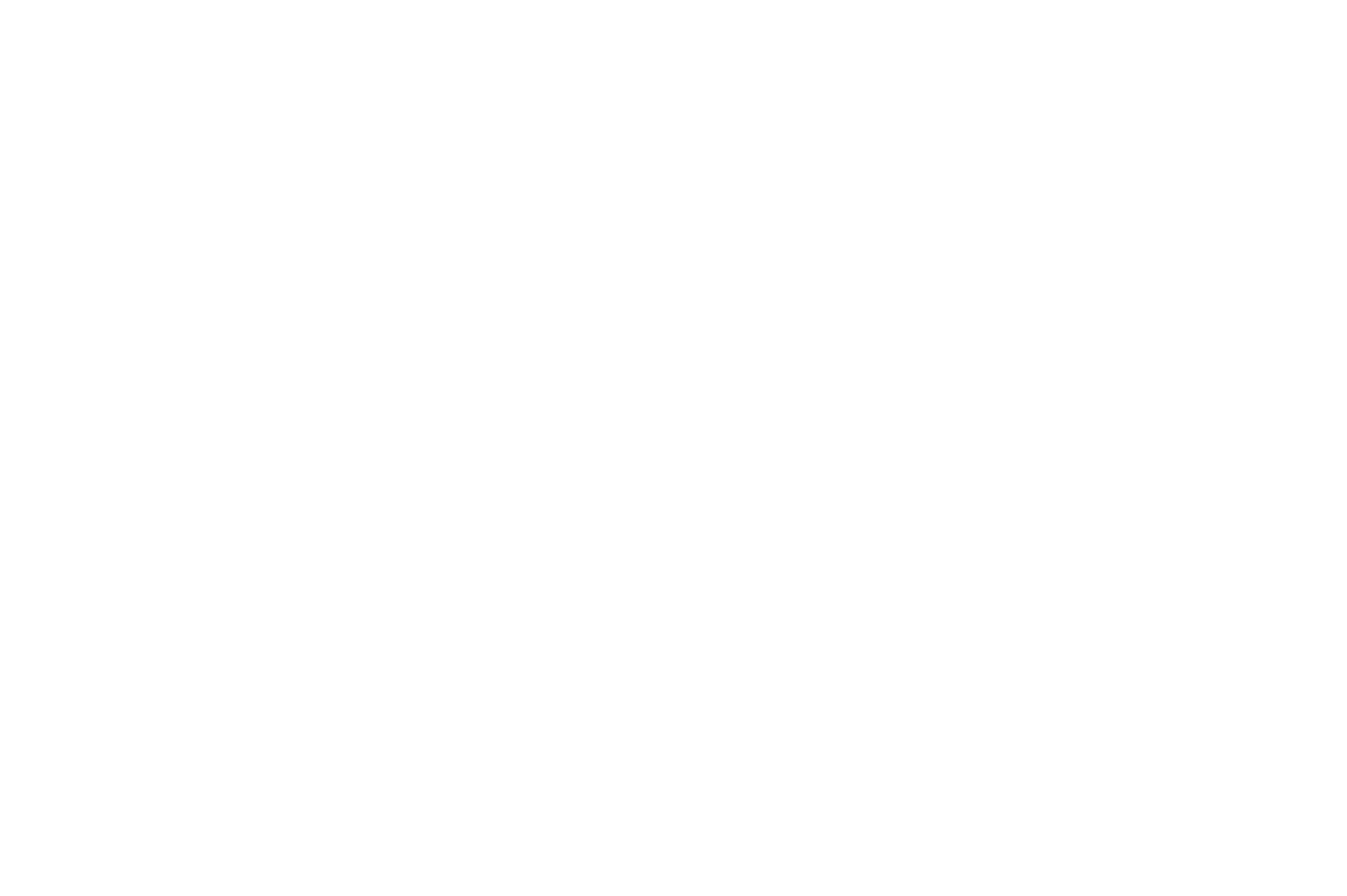
© Monika Rittershaus
Das andere Ende vom Lied
Der Mythos der Semele wird oft als Parabel der zerstörerischen Kraft menschlicher Anmaßung und Selbstüberhebung gelesen, und nicht selten wird die Königstochter als eitle, verblendete und nicht besonders kluge Narzisstin dargestellt. In Barrie Koskys Inszenierung häufelt sie inmitten der verkohlten Ruinen vormals grandioser Gemächer ganz vorsichtig ihre eigene Asche in eine schlichte Urne. Die Götter bringen mit einem Händeklatschen die Welt, an deren Ende dann – »Happy, happy« – doch noch eine »glückliche« Hochzeit steht, ins Lot und verlassen stumm schreitend den Schauplatz vergeblichen menschlichen Ringens um die Erhebung aus dem drückenden Mittelmaß. Bei Congreve sind es die Worte des Apoll, des Gottes der Mäßigung, der Struktur und der Ordnung, die dem Ende eine tröstende Wendung geben.
Apoll fordert darin nicht etwa Mäßigung, sondern verkündet vielmehr die Geburt eines neuen Gottes, der gerade das Gegenteil verkörpert: Dionysos, der Gott des Rausches und des Exzesses möge wie Phönix aus der Asche seiner vernichteten Mutter Semele erstehen.
In Händels Musik und Koskys Inszenierung hat sich der neugeborene Gott indes schon längst zuvor gezeigt. In jenem Ausbruch des Wunsches nach absoluter Erfüllung, jener furiosen Arie der Semele, in der sie ihr »No, no, I take no less, then all in full excess!« in alle Welt herausbrüllt. Den Preis dafür nimmt sie bereitwillig in Kauf.
Apoll fordert darin nicht etwa Mäßigung, sondern verkündet vielmehr die Geburt eines neuen Gottes, der gerade das Gegenteil verkörpert: Dionysos, der Gott des Rausches und des Exzesses möge wie Phönix aus der Asche seiner vernichteten Mutter Semele erstehen.
In Händels Musik und Koskys Inszenierung hat sich der neugeborene Gott indes schon längst zuvor gezeigt. In jenem Ausbruch des Wunsches nach absoluter Erfüllung, jener furiosen Arie der Semele, in der sie ihr »No, no, I take no less, then all in full excess!« in alle Welt herausbrüllt. Den Preis dafür nimmt sie bereitwillig in Kauf.
Mehr dazu
12. März 2025
Menschliche Kaleidoskope
In Barrie Koskys Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny gibt es kein Entkommen: Jeder sieht sich selbst – vervielfacht, verzerrt, gefangen im eigenen Spiegelbild. Zwischen Gier, Macht und Untergang entfaltet sich eine Welt, in der alles erlaubt und der Absturz garantiert ist. In Mahagonny vereinen sich Brechts so schneidender Blick auf die Gesellschaft und Weills grandios-mitreissende Musik zu einem schmerzhaften und aktuellen Blick auf Narzissmus – und auf eine Gesellschaft, die ihren Gemeinsinn verliert. In ganz realen Spiegeln auf der sonst kargen Bühne entfaltet Barrie Kosky die Oper zu einem Kaleidoskop menschlicher Absurdität und fragt: Was bleibt von uns, wenn wir uns selbst nicht mehr erkennen? Ein Gespräch über die Bibel, Selfies und den Sündenbock in seiner Inszenierung.
#KOBMahagonny
Interview
20. März 2024
Wo ein Wille ist
Regisseur Barrie Kosky und Dirigent Adam Benzwi im Gespräch über Schutzengel, Wiener Wohnzimmer, eiskalten Martini und ihre Inzenenierung Eine Frau, die weiss, was sie will!
#KOBEineFrau
Interview
6. März 2024
Spielwut von Knast bis Klapse
Dagmar Manzel und Max Hopp über Tempo, Sandkästen und die Schauspielerei in Eine Frau, die weiß, was sie will.
#KOBEineFrau