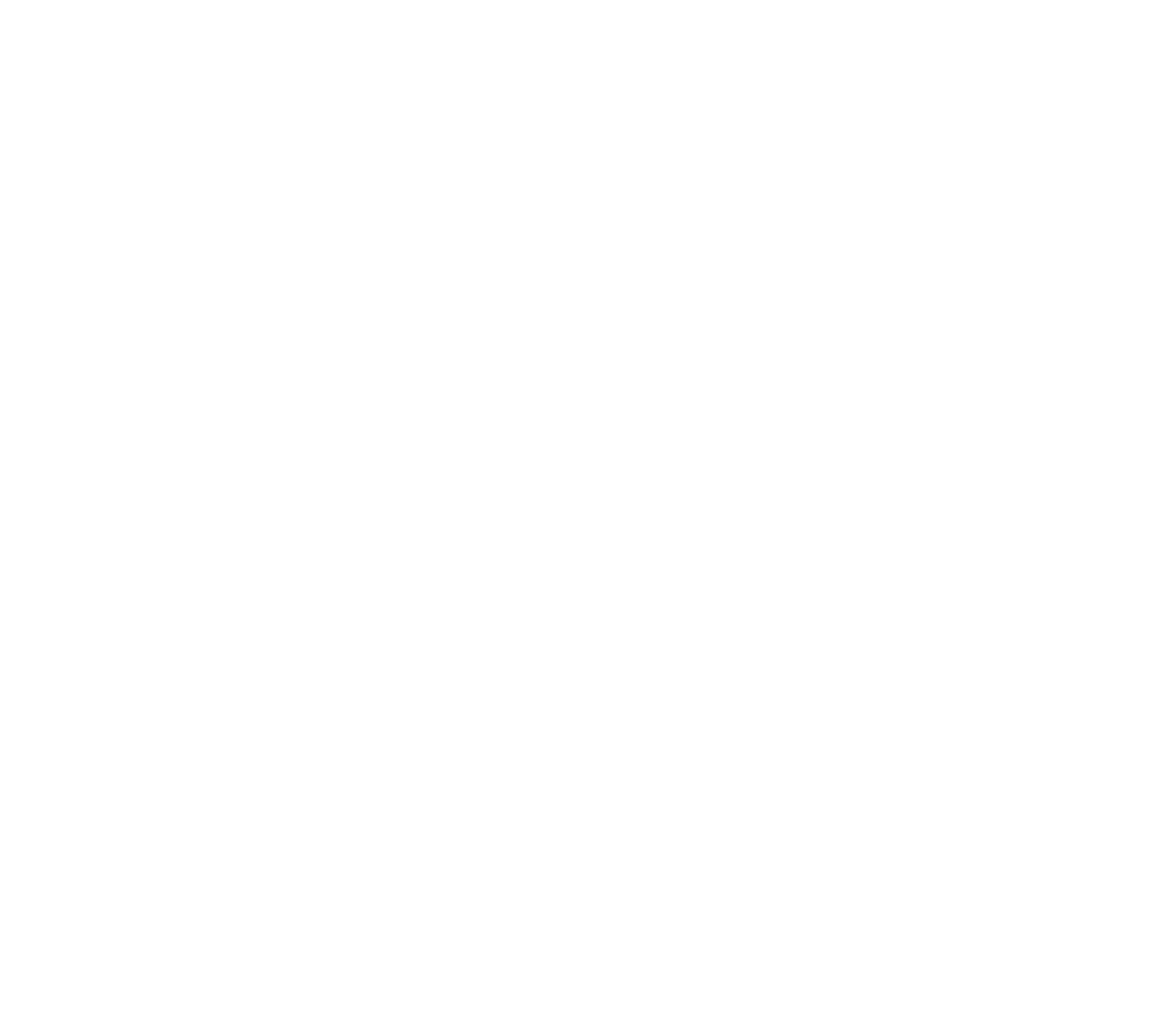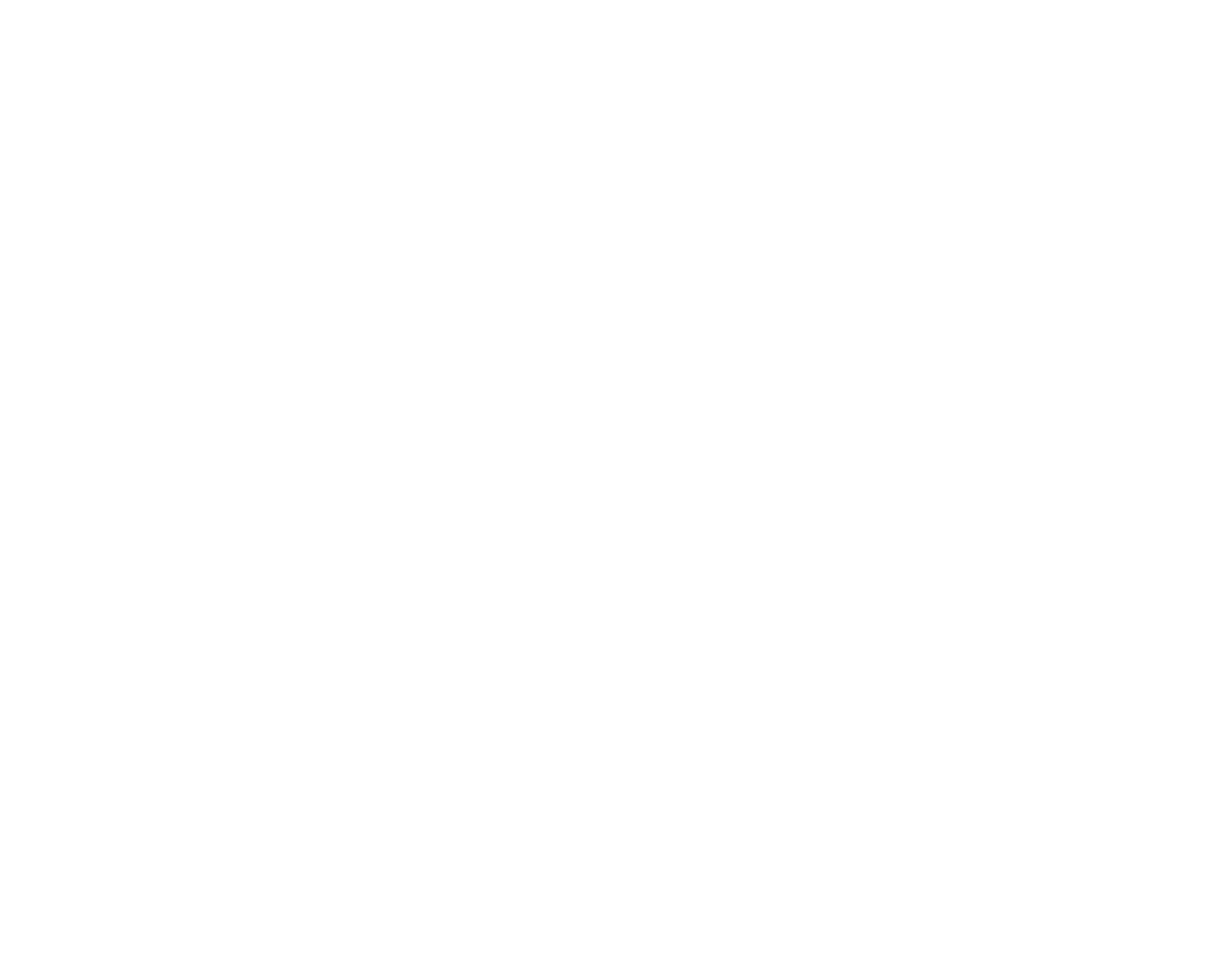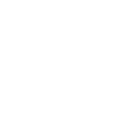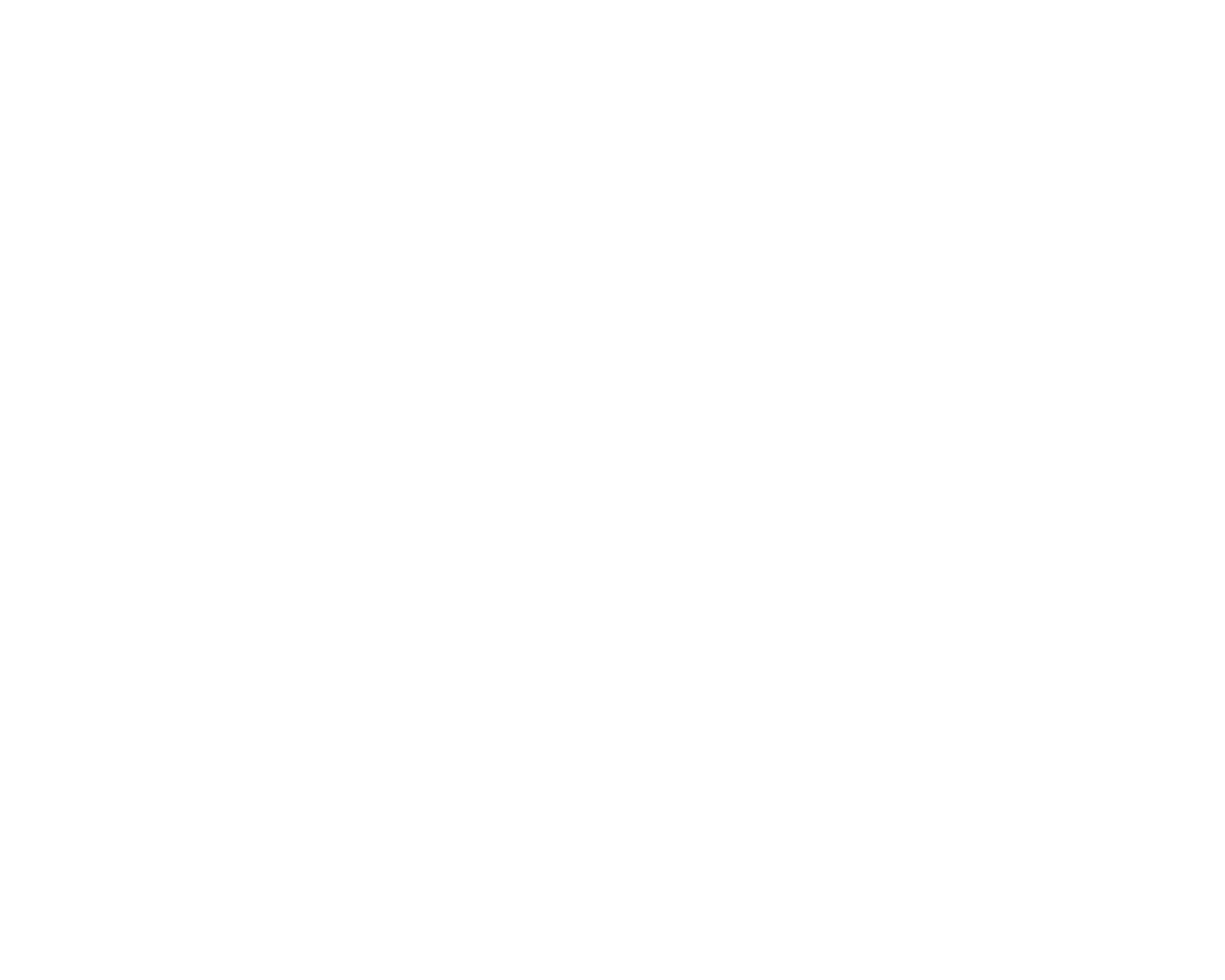© Jan Windszus Photography
Echt flott!
Als in den 1950er Jahren das angloamerikanische Musical weltweit Erfolge feierte, ersannen die Kulturgenossen der damaligen DDR einen verwegenen Plan: als Antwort auf den »Klassenfeind« muss ein eigenes Genre auf den Bühnen des Staates auferstehen. Geboren war das sogenannte »Heitere Musiktheater«, eine Art realsozialistische Operettenform. Die Stücke um Liebesgeschichten literaturunkundiger Fußballer, allzu strenger Vopos und ehrgeiziger Modedesigner waren Zuckerstückchen auf den Spielplänen von Ahlbeck bis Zwickau, wurden allerdings nach der politischen Wende 1989 nur noch selten gespielt. Mit Messeschlager Gisela macht die Komische Oper Berlin nun den Anfang, diesen Teil deutscher Kulturgeschichte wieder auf die Bühne zu bringen. Im Gespräch Dramaturgin Johanna Wall sprechen Regisseur Axel Ranisch und der musikalischen Leiter Adam Benzwi über verschüttete Traditionen, echten Gemeinsinn und die hohe Kunst der Fröhlichkeit im »Heiteren Musiktheater«.
Die Komische Oper Berlin legte in den vergangenen Jahren einen programmatischen Fokus auf das Erbe der Operetten der Weimarer Republik, die insbesondere in den Inszenierungen des damaligen Intendanten Barrie Kosky zu einer landesweiten Renaissance der Werke von Komponisten wie Paul Abraham, Emmerich Kálmán oder Oscar Straus führten. Nun wendet sich das Haus einer weiteren Operetten-Tradition zu, die droht, in Vergessenheit zu geraten – vorausgesetzt, dass sie dem Publikum je bekannt war: Das »Heitere Musiktheater«, die sogenannte DDR-Operette. Die Musicals, Operetten und musikalischen Komödien aus der Feder von Komponisten wie Herbert Kawan, Georg Masanetz, Conny Odd, Georg Kneifel, Gerd Natschinski und anderen wurden vom volkseigenen Musikverlag Lied der Zeit unter diesem Begriff zusammengefasst. Heute allerdings finden sich in den einschlägigen Nachschlagewerken, wenn überhaupt, nur knappe Hinweise auf die über 200 Werke dieses Genres, die von 1949 bis 1989 in der damaligen DDR entstanden.
Adam Benzwi: … eine unglaubliche Menge dafür, dass man nahezu nichts kennt. Zumindest nicht in meiner Generation. Gab es in Westdeutschland zur gleichen Zeit überhaupt erfolgreiche eigene Musicals? Mir fallen zwei ein. Man hat Musikfilme gemacht und man spielte die Musicals aus den USA.
Das »Heitere Musiktheater« war auch eine Reaktion auf die Westimporte, insbesondere die erfolgreichen amerikanischen Musicals, die auch in Ostdeutschland gespielt werden konnten. An der Komischen Oper fanden bspw. legendäre Musical-Erstaufführungen statt, so Der Fiedler auf dem Dach (Anatevka) in der Regie von Walter Felsenstein oder Porgy and Bess mit Manfred Krug in einer Hauptrolle. Das konnten sich andere Theater so nicht ohne weiteres leisten. Der Kurs der Ost- zur Westmark stand 1:4. Selbst mit vergünstigten Sonder-Konditionen waren die Rechte zu teuer. Daneben existierten ideologische Gründe – so wurde angeregt, die eigene Musiktheaterproduktion anzukurbeln, denn man wollte auch in der Kunstproduktion beweisen, dass gute Unterhaltung mit ideologischem Anspruch vereinbar ist.
Axel Ranisch: Und man hatte hochkarätige Künstler:innen, die man beschäftigen konnte. In der DDR wurden Musiker:innen und Komponist:innen ja vom Staat gezahlt.
Adam Benzwi: Ich frage mich aber auch, ob in der DDR – anders als im sich weitgehend unhinterfragt amerikanisierenden Westdeutschland – nicht auch eine Tradition der Vorkriegszeit weitergeführt wurde. Elvis Presley im Westen: die Begeisterung verstehe ich ja, teile ich auch! Ich vermisse nur in der BRD der 50er Jahre die Fortsetzung der Tradition des Musiktheaters, in deutscher Sprache.
Axel Ranisch: Zudem sollten die Arbeiter im Zentrum stehen. Es sollten Geschichten von einfachen Leuten erzählt werden, von Arbeitern und Bauern. In Sowjet-Russland fällt mir als Pendant Schostakowitschs Operette Moskau Tscherjomuschki ein. Die spielt auch im Arbeitermilieu …
Adam Benzwi: Das Milieu, in dem die Geschichten stattfinden, mag ein anderes sein. Aber als Genre sehe ich hier eine Weiterführung: Gesangsnummern, komödiantische Dialoge und Orchester – das findet man in dieser Zeit in diesem Ausmaß in Westdeutschland nicht.
Axel Ranisch: Das Genre ist wie eine Weiterführung des Singspiels. Ich denke oft an Lortzings Zar und Zimmermann, wenn ich unsere Messerschlager höre, mehr noch, als dass ich an Musical denke.
Adam Benzwi: … eine unglaubliche Menge dafür, dass man nahezu nichts kennt. Zumindest nicht in meiner Generation. Gab es in Westdeutschland zur gleichen Zeit überhaupt erfolgreiche eigene Musicals? Mir fallen zwei ein. Man hat Musikfilme gemacht und man spielte die Musicals aus den USA.
Das »Heitere Musiktheater« war auch eine Reaktion auf die Westimporte, insbesondere die erfolgreichen amerikanischen Musicals, die auch in Ostdeutschland gespielt werden konnten. An der Komischen Oper fanden bspw. legendäre Musical-Erstaufführungen statt, so Der Fiedler auf dem Dach (Anatevka) in der Regie von Walter Felsenstein oder Porgy and Bess mit Manfred Krug in einer Hauptrolle. Das konnten sich andere Theater so nicht ohne weiteres leisten. Der Kurs der Ost- zur Westmark stand 1:4. Selbst mit vergünstigten Sonder-Konditionen waren die Rechte zu teuer. Daneben existierten ideologische Gründe – so wurde angeregt, die eigene Musiktheaterproduktion anzukurbeln, denn man wollte auch in der Kunstproduktion beweisen, dass gute Unterhaltung mit ideologischem Anspruch vereinbar ist.
Axel Ranisch: Und man hatte hochkarätige Künstler:innen, die man beschäftigen konnte. In der DDR wurden Musiker:innen und Komponist:innen ja vom Staat gezahlt.
Adam Benzwi: Ich frage mich aber auch, ob in der DDR – anders als im sich weitgehend unhinterfragt amerikanisierenden Westdeutschland – nicht auch eine Tradition der Vorkriegszeit weitergeführt wurde. Elvis Presley im Westen: die Begeisterung verstehe ich ja, teile ich auch! Ich vermisse nur in der BRD der 50er Jahre die Fortsetzung der Tradition des Musiktheaters, in deutscher Sprache.
Axel Ranisch: Zudem sollten die Arbeiter im Zentrum stehen. Es sollten Geschichten von einfachen Leuten erzählt werden, von Arbeitern und Bauern. In Sowjet-Russland fällt mir als Pendant Schostakowitschs Operette Moskau Tscherjomuschki ein. Die spielt auch im Arbeitermilieu …
Adam Benzwi: Das Milieu, in dem die Geschichten stattfinden, mag ein anderes sein. Aber als Genre sehe ich hier eine Weiterführung: Gesangsnummern, komödiantische Dialoge und Orchester – das findet man in dieser Zeit in diesem Ausmaß in Westdeutschland nicht.
Axel Ranisch: Das Genre ist wie eine Weiterführung des Singspiels. Ich denke oft an Lortzings Zar und Zimmermann, wenn ich unsere Messerschlager höre, mehr noch, als dass ich an Musical denke.
Raffinierte Schlagermusik
Gerd Natschinski nennt Lortzing und sogar Mozart als seine großen Inspirationsquellen. Kann man das irgendwo wiedererkennen?
Adam Benzwi: Messeschlager Gisela hat eine eigene Handschrift. Nimmt man zum Beispiel die Holzbläser. In der Partitur tauchen die schönen Melodielinien in Flöte, Klarinette und Oboe auf. Diese Orchestrierung ist ungewöhnlich und schön und man kann sie nur mit einem klassischen Orchester umsetzen, wie es uns hier zur Verfügung steht.
Kanntet ihr Messerschlager Gisela ehe ihr zu der Produktion eingeladen wurdet?
Axel Ranisch: Nein. Aber ich war überrascht, was ich von Gerd Natschinski alles kenne. Z. B. die Musik zum Film Heißer Sommer oder den Schlager Damals von Bärbel Wachholz.
Adam Benzwi: Ich kannte auch Heißer Sommer und Natschinskis wohl erfolgreichstes Bühnenwerk, das Musical Mein Freund Bunbury. Ich habe Nummern daraus mit meinen Student:innen einstudiert. Von Messeschlager Gisela habe ich gehört, mich aber jetzt erst damit beschäftigt.
Adam Benzwi: Messeschlager Gisela hat eine eigene Handschrift. Nimmt man zum Beispiel die Holzbläser. In der Partitur tauchen die schönen Melodielinien in Flöte, Klarinette und Oboe auf. Diese Orchestrierung ist ungewöhnlich und schön und man kann sie nur mit einem klassischen Orchester umsetzen, wie es uns hier zur Verfügung steht.
Kanntet ihr Messerschlager Gisela ehe ihr zu der Produktion eingeladen wurdet?
Axel Ranisch: Nein. Aber ich war überrascht, was ich von Gerd Natschinski alles kenne. Z. B. die Musik zum Film Heißer Sommer oder den Schlager Damals von Bärbel Wachholz.
Adam Benzwi: Ich kannte auch Heißer Sommer und Natschinskis wohl erfolgreichstes Bühnenwerk, das Musical Mein Freund Bunbury. Ich habe Nummern daraus mit meinen Student:innen einstudiert. Von Messeschlager Gisela habe ich gehört, mich aber jetzt erst damit beschäftigt.

© Jan Windszus Photography
Was macht die Musik von Gerd Natschinski so hörenswert?
Adam Benzwi: Schlager gab es im Westen wie im Osten. Aber dies hier ist gut gemachte Theatermusik, und das ist etwas anderes. Anders als im klar strukturierten Schlager finden sich hier raffiniert gebaute szenische Musiken, bei denen man singt und springt. Hier wird eine deutsche Tradition weiterentwickelt, neu dabei sind die Harmonien, Rhythmen, das Arrangement und die Inhalte. Messeschlager Gisela ist eine Operette an der Grenze zum Musical mit szenischen Musiken, mit großem Orchester für ausgebildete Sänger:innen , Schauspieler:innen und klassisch ausgebildete Orchestermusiker. Unser Arrangeur Daniel Busch kannte das Werk auch nicht. Für die Bearbeitung für ein 30-Mann-Orchester – im Original waren es um die 50! (die aber nicht ins Zelt passen) – hat er die Partitur Ton für Ton aufgeschrieben und meinte danach: Das ist sehr gut gemacht – wie ein gut gebautes Haus mit einem soliden Fundament und vielen Überraschungen darüber.
Die Musiker spielen das gern.
Axel Ranisch: … eine handwerklich gut gemachte Musik und darüber hinaus auch noch so melodisch und eingängig.
Adam Benzwi: Eine gute Melodie zu schreiben, die eingängig ist und berührt: das ist eine hohe Kunst. Das zeigt sich die Genialität und Größe von Natschinski.
Axel Ranisch: Das sind 15, 16 richtige Knaller-Melodien, richtige Ohrwürmer. Nenn mir eine Oper, die so viele Ohrwürmer produziert, wie dieses Stück (Benzwi summt).
Adam Benzwi: Ein Reichtum, der aus der Operettentradition kommt. Und man merkt Gerd Natschinski an, dass er sowohl aus der Praxis der Schlagerproduktion kommt und für unterschiedliche Schlagersänger:innen komponiert hat. Er ist ein Mann des Theaters, der eben die Regeln kannte und der wusste, was gut funktioniert wie alle guten Bühnenkomponisten. Bei den Orchesterproben von »Ein Kleid für dich« habe ich die große Fröhlichkeit im Raum beobachtet. Das Stück ist einfach zu spielen, Fast schämt man sich, wenn man sich an etwas scheinbar trivial so freut. Aber diese Freude ist echt. Es sagt sich leicht, »Die 50er-Jahre-Operette war doch der reinste Zuckerguss, furchtbar.« Jetzt aber berührt mich diese Fröhlichkeit. Das Stück ist 15 Jahre nach dem 2. Weltkrieg entstanden, da war das Bedürfnis nach Fröhlichkeit groß. Und Fröhlichkeit, das brauchen wir auch heute.
Adam Benzwi: Schlager gab es im Westen wie im Osten. Aber dies hier ist gut gemachte Theatermusik, und das ist etwas anderes. Anders als im klar strukturierten Schlager finden sich hier raffiniert gebaute szenische Musiken, bei denen man singt und springt. Hier wird eine deutsche Tradition weiterentwickelt, neu dabei sind die Harmonien, Rhythmen, das Arrangement und die Inhalte. Messeschlager Gisela ist eine Operette an der Grenze zum Musical mit szenischen Musiken, mit großem Orchester für ausgebildete Sänger:innen , Schauspieler:innen und klassisch ausgebildete Orchestermusiker. Unser Arrangeur Daniel Busch kannte das Werk auch nicht. Für die Bearbeitung für ein 30-Mann-Orchester – im Original waren es um die 50! (die aber nicht ins Zelt passen) – hat er die Partitur Ton für Ton aufgeschrieben und meinte danach: Das ist sehr gut gemacht – wie ein gut gebautes Haus mit einem soliden Fundament und vielen Überraschungen darüber.
Die Musiker spielen das gern.
Axel Ranisch: … eine handwerklich gut gemachte Musik und darüber hinaus auch noch so melodisch und eingängig.
Adam Benzwi: Eine gute Melodie zu schreiben, die eingängig ist und berührt: das ist eine hohe Kunst. Das zeigt sich die Genialität und Größe von Natschinski.
Axel Ranisch: Das sind 15, 16 richtige Knaller-Melodien, richtige Ohrwürmer. Nenn mir eine Oper, die so viele Ohrwürmer produziert, wie dieses Stück (Benzwi summt).
Adam Benzwi: Ein Reichtum, der aus der Operettentradition kommt. Und man merkt Gerd Natschinski an, dass er sowohl aus der Praxis der Schlagerproduktion kommt und für unterschiedliche Schlagersänger:innen komponiert hat. Er ist ein Mann des Theaters, der eben die Regeln kannte und der wusste, was gut funktioniert wie alle guten Bühnenkomponisten. Bei den Orchesterproben von »Ein Kleid für dich« habe ich die große Fröhlichkeit im Raum beobachtet. Das Stück ist einfach zu spielen, Fast schämt man sich, wenn man sich an etwas scheinbar trivial so freut. Aber diese Freude ist echt. Es sagt sich leicht, »Die 50er-Jahre-Operette war doch der reinste Zuckerguss, furchtbar.« Jetzt aber berührt mich diese Fröhlichkeit. Das Stück ist 15 Jahre nach dem 2. Weltkrieg entstanden, da war das Bedürfnis nach Fröhlichkeit groß. Und Fröhlichkeit, das brauchen wir auch heute.

© Jan Windszus Photography
Gab es nie die Idee auch andere Stücke einzubauen, wie Du das zum Beispiel in Ball im Savoy von Paul Abraham gemacht hast?
Adam Benzwi: Die Überlegung, andere Stücke hinzuzufügen, haben wir beim Machen schnell fallen lassen. Wir haben erkannt, dass das Stück gut ist, wie es ist. Jedwede weitere Zutat würde hier schaden.
Kollegial-charmante Seitenhiebe
Apropos »doppelter Boden« – eine ganz große Rolle im Stück spielt das Thema Vertrauen zueinander. Und das Vertrauen zu sich selbst.
Axel Ranisch: Das ist die Qualität dieses Stoffes. Die Konflikte brauchen den Zeitkontext, in dem sie geschrieben worden sind, nicht unbedingt, sondern funktionieren auch jetzt.
Bei manchen Aspekten könnte man sich direkt eine Scheibe abschneiden …
Axel Ranisch: Der Zusammenhalt im Betrieb ist exemplarisch. So wie hier miteinander umgegangen wird, wie man sich gegenseitig auf ein Eisbein einlädt, sich knufft und Hops nimmt und auf so eine charmante Art und Weise in die Pfanne haut – da ist überall so etwas Kollegiales, Freundschaftliches. Außer diesem Kuckuck, der steht halt leider außerhalb als Sinnbild für das Hierarchische.
Kuckuck scheint aber auch, als mache er den Chefmodegestalter mehr aus einer Mischung aus Pflichtbewusstsein und Größenwahn als aus Leidenschaft. Zu guter Letzt ist er doch ganz erleichtert, wenn er den Posten abgeben darf.
Axel Ranisch: Wie unerträglich furchtbar, wenn man in etwas Chef sein soll, dass man einfach nicht gut beherrscht. Und das ist gar nicht unsere Erfindung! Das steht so im Stück, gut zu hören in der Audioaufnahme des Metropol-Theaters aus den 1960er Jahren.
Axel Ranisch: Das ist die Qualität dieses Stoffes. Die Konflikte brauchen den Zeitkontext, in dem sie geschrieben worden sind, nicht unbedingt, sondern funktionieren auch jetzt.
Bei manchen Aspekten könnte man sich direkt eine Scheibe abschneiden …
Axel Ranisch: Der Zusammenhalt im Betrieb ist exemplarisch. So wie hier miteinander umgegangen wird, wie man sich gegenseitig auf ein Eisbein einlädt, sich knufft und Hops nimmt und auf so eine charmante Art und Weise in die Pfanne haut – da ist überall so etwas Kollegiales, Freundschaftliches. Außer diesem Kuckuck, der steht halt leider außerhalb als Sinnbild für das Hierarchische.
Kuckuck scheint aber auch, als mache er den Chefmodegestalter mehr aus einer Mischung aus Pflichtbewusstsein und Größenwahn als aus Leidenschaft. Zu guter Letzt ist er doch ganz erleichtert, wenn er den Posten abgeben darf.
Axel Ranisch: Wie unerträglich furchtbar, wenn man in etwas Chef sein soll, dass man einfach nicht gut beherrscht. Und das ist gar nicht unsere Erfindung! Das steht so im Stück, gut zu hören in der Audioaufnahme des Metropol-Theaters aus den 1960er Jahren.
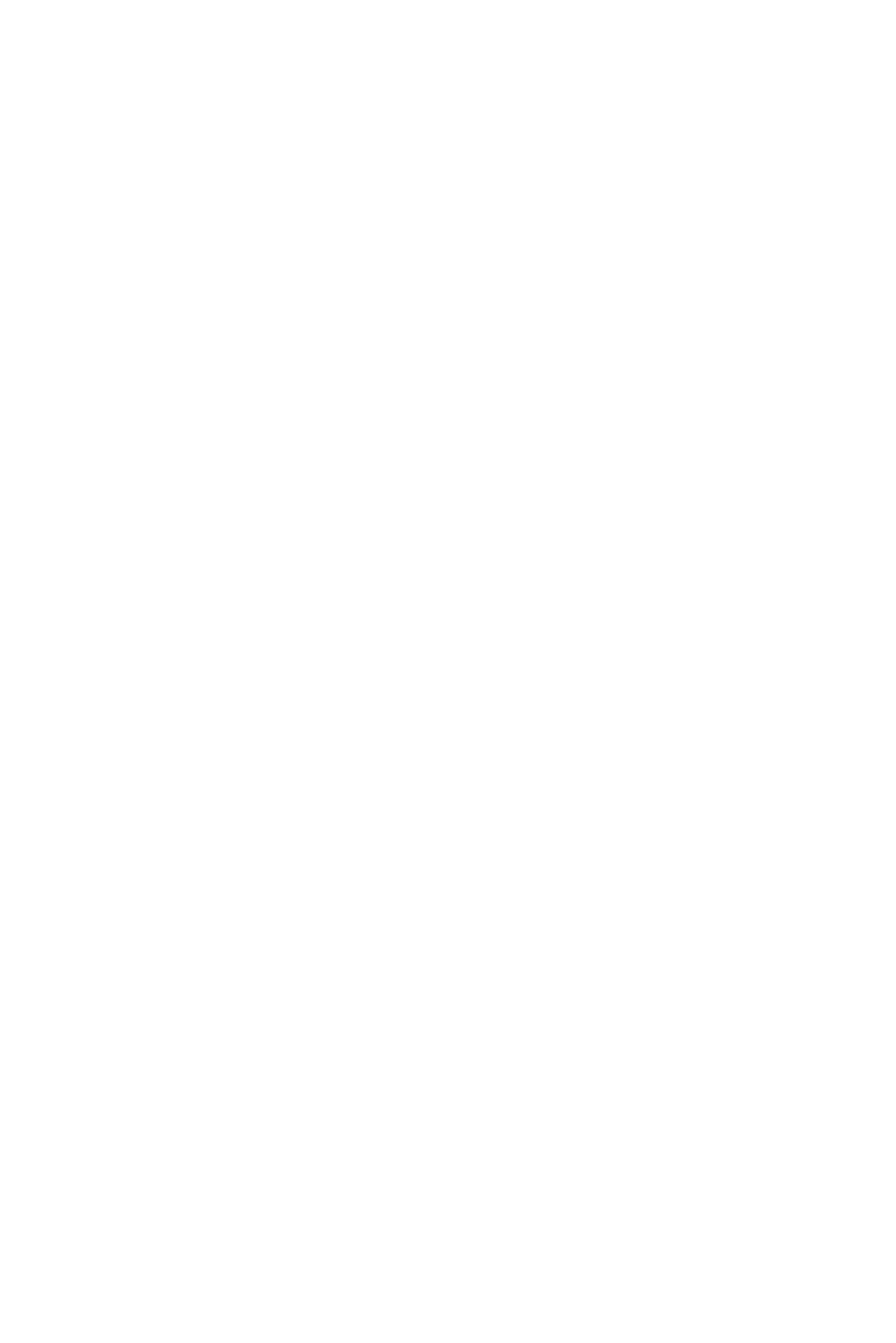
© Jan Windszus Photography
Gisela ist auf den eine leitende Position auch nicht scharf. Sie spricht nie von »ihrem« Kleid, sondern stets von »unserem« Modell.
Adam Benzwi: Wir sind in der Welt von Messeschlager Gisela in einem volkseigenen Betrieb, und Ideen kommen von uns allen. Das ist etwas, was in meinen Augen wirklich DDR-spezifisch ist. Und wie ich finde, eine schöne Sache. Ich gucke gerade für ein anderes Vorhaben westdeutsche Heimatfilme an. Darin gibt es immer ein Hotel in den Alpen, und immer eine reiche Amerikanerin, und die bürgerliche Familie aus Berlin, mit dem Kindermädchen in Berlin, das berlinert und dazu den dienenden Peter Alexander – einfach Hierarchien! Diese Welt, die man aus den westdeutschen Musikfilmen jener Zeit kennt, die findet sich in Messeschlager Gisela gar nicht.
Axel Ranisch: Im Gegenteil: Alle Figuren, die glauben, etwas Besseres zu sein, kriegen im Laufe des Stücks ein bisschen was auf den Deckel. Fred, der am Anfang als arroganter Journalist auftritt, Kuckuck, der den Chef mimt, und auch die zum Star-Mannequin entwickelte Chefsekretärin Marghueritta alias Grete Kulicke.
Adam Benzwi: Das allerdings haben die DDR und die BRD gemein: Über Wichtigtuer macht man sich gerne lustig.
Gibt es auch etwas, das ihr verändert habt?
Axel Ranisch: Nun, man merkt dem Stück schon an, dass es von zwei Männern geschrieben wurde. Ich habe also versucht, die Frauenfiguren, die ich stark vorgefunden habe, noch weiter zu stärken. Aus zwei Nebenfiguren haben wir dann eine gemacht: Inge. Theo Rüster, der Darsteller der Inge, meinte als erstes: »Das Stück ist so unzynisch.« Und das stimmt. Die Figuren können auch mal ironisch miteinander sein, aber eben dieser Schritt ins Zynische, ins Coole, ins Abstandnehmen und Von-oben-herab-Draufgucken, der passiert nie. Und das ist wirklich erfrischend.
Adam Benzwi: Wir sind in der Welt von Messeschlager Gisela in einem volkseigenen Betrieb, und Ideen kommen von uns allen. Das ist etwas, was in meinen Augen wirklich DDR-spezifisch ist. Und wie ich finde, eine schöne Sache. Ich gucke gerade für ein anderes Vorhaben westdeutsche Heimatfilme an. Darin gibt es immer ein Hotel in den Alpen, und immer eine reiche Amerikanerin, und die bürgerliche Familie aus Berlin, mit dem Kindermädchen in Berlin, das berlinert und dazu den dienenden Peter Alexander – einfach Hierarchien! Diese Welt, die man aus den westdeutschen Musikfilmen jener Zeit kennt, die findet sich in Messeschlager Gisela gar nicht.
Axel Ranisch: Im Gegenteil: Alle Figuren, die glauben, etwas Besseres zu sein, kriegen im Laufe des Stücks ein bisschen was auf den Deckel. Fred, der am Anfang als arroganter Journalist auftritt, Kuckuck, der den Chef mimt, und auch die zum Star-Mannequin entwickelte Chefsekretärin Marghueritta alias Grete Kulicke.
Adam Benzwi: Das allerdings haben die DDR und die BRD gemein: Über Wichtigtuer macht man sich gerne lustig.
Gibt es auch etwas, das ihr verändert habt?
Axel Ranisch: Nun, man merkt dem Stück schon an, dass es von zwei Männern geschrieben wurde. Ich habe also versucht, die Frauenfiguren, die ich stark vorgefunden habe, noch weiter zu stärken. Aus zwei Nebenfiguren haben wir dann eine gemacht: Inge. Theo Rüster, der Darsteller der Inge, meinte als erstes: »Das Stück ist so unzynisch.« Und das stimmt. Die Figuren können auch mal ironisch miteinander sein, aber eben dieser Schritt ins Zynische, ins Coole, ins Abstandnehmen und Von-oben-herab-Draufgucken, der passiert nie. Und das ist wirklich erfrischend.
Mehr dazu
6. März 2024
Spielwut von Knast bis Klapse
Dagmar Manzel und Max Hopp über Tempo, Sandkästen und die Schauspielerei in Eine Frau, die weiß, was sie will.
#KOBEineFrau
12. Juni 2024
Ein vergessener Kontinent
Messeschlager Gisela gehört zu den bekanntesten Vertretern des »Heiteren Musiktheaters« der DDR. Dennoch verschwand das Stück irgendwann von den Bühnen – und wurde, wenn, dann nur sehr gestutzt aufgeführt. Zu deutlich waren die teils subversiven, teils direkten kritischen Wortspiele über realsozialistische Verhältnisse, zu augenzwinkernd die humorgeladene Gegenüberstellung ost- und westdeutscher Lebensverhältnisse. Nun hat die Komische Oper Berlin den Erfolgsschlager der besonderen Art DDR-Operette wieder auf die Bühne gebracht und lädt ein, die Geschichte eines 'sozialistischen' Musiktheaters neu zu betrachten. Ein Einblick zu dessen Hintergründen...
#KOBGisela
Einführung
09.06.2024
Ausgrabung mit Kult-Potenzial
Die Musik ist grandios. Da stimmt alles. Das Tempo und das Timing, die schlagertauglichen Nummern. Alles da und sogar auf Weltniveau, wie es in der DDR immer so schön illusorisch hieß. Und es wird auf dem üblichen Niveau des Hauses von Adam Benzwi von einer Formation des Orchesters der Komischen Oper für das Zelt zündend serviert. ... Gisa Flake gibt die Titelrolle nicht nur schauspielerisch überzeugend als Melange aus Original und Sympathieträgerin, sie singt auch noch fabelhaft. Maria-Danaé Bansen stellt sowohl ihre atemberaubende Berliner Schnauze als auch ihr Sexappeal der Sekretärin Kulicke zur Verfügung. Thorsten Merten ist wie geschaffen für diesen Kuckuck, Andreja Schneider ein Musterbeispiel für den dosierten Einsatz eines weiblichen Selbstbewusstseins, wie man es wohl gerne mehr gehabt hätte.
Roberto Becker, Die Deutsche Bühne
#KOBGisela
09.06.2024
DDR-Operette im Theaterzelt vorm Roten Rathaus: Nadelöhr der Liebe
Ranischs verspielte Version lebt von der Diversität seiner Darsteller, die allesamt echte Charaktere sind, schräge Typen, weit entfernt von der hochprofessionellen Austauschbarkeit der Casts im Kommerzmusical amerikanischer Prägung. Hier treffen singende Schauspieler wie Nico Holonics, Thorsten Merten und Martin Reik auf Andreja Schneider von den Geschwistern Pfister und Johannes Dunz aus dem Komische-Oper-Ensemble. Für Theo Rüster hat Ranisch aus zwei Nebenrollen die schwule Inge erfunden. ... Im Fokus aber stehen zwei fantastische Frauen: einerseits Gisa Flake als uneitle, sturköpfige Titelheldin mit Power-Präsenz, andererseits Maria-Danae Bansen als platinblonde, brachial berlinernde Chefsekretärin Margueritta Kulicke.
Frederik Hanssen, Der Tagesspiegel
#KOBGisela
7. Juni 2024
Broadwayfeeling mit Gisela
Ach, möchte man schwärmen, wie schön die Zeit, als das Prinzip 'flacher Hierarchien' noch als Kollegialität verstanden wurde – und Teams Kollektive hießen. Dennoch: so sehr Axel Ranischs Inszenierung der DDR-Operette Messeschlager Gisela eine Zeitreise in die 1960er ist – zum Schwelgen in Nostalgie lädt sie nicht ein. Vielmehr versteckt sich in dem Stück eine ganz aktuelle Geschichte über Zusammenhalt, kollegial-charmante Seitenhiebe unter Kolleg:innen und über die Selbstfindung in der ersten Reihe. Mittendrin: Modegestalterin Gisela Claus, die lernen muss, mit der Wertschätzung ihrer Arbeit zu leben. Eine Geschichte, in der sich die Darstellerin Gisa Flake wiederfindet. Im Gespräch spricht sie über ihre Liebe zur Rolle der Gisela, der Kapitulation vor Komplimenten und wie viel Broadwayfeeling auf der Bühne im Zelt am Roten Rathaus auflebt.
#KOBGisela
Interview
8. März 2024
»Du bist in Berlin, Baby!«
Barrie Kosky und Adam Benzwi über Humor, Liebesflöten und das perfekte Timing in ihrer Inszenierung Die Perlen der Cleopatra
#KOBCleopatra
Interview
3. November 2023
Ein Hoch auf die Nummer zwei!
Der musikalische Leiter Adam Benzwi im Gespräch über linke Hände, die hohe Schule der Travestieclubs und pure Lebensfreude in Barrie Koskys Inszenierung Chicago.
#KOBChicago
29.10.2023
Killer-Girls rocken den Knast
Katharine Mehrling als berlinernde Göre Roxy röhrt, tanzt, singt, bettelt, lügt, jammert, gewinnt und verliert einfach hinreißend, ebenso Ruth Brauer-Kvam, ihre Schicksalsschwester Velma, ruchlos, neidisch, böse und geschockt.
Maria Ossowski, rbb24/ARD
#KOBChicago
#Vaudeville
#Musical
29.10.2023
Unmoral siegt!
...hier kickt bald der Musical-Drive, den so nur die Komische Oper kann, groovt das Orchester unter Adam Benzwi besonders lässig und jazzy, reißt es das Publikum am Ende von den Sitzen.
Georg Kasch, Nachtkritik
#KOBChicago
#Vaudeville
#Musical
29.10.2023
Barrie Kosky zeigt die Welt als eine selbstverliebte Show
Nach fünf Minuten weiß man in der Premiere bereits, dass das Ensemble der Komischen Oper in seiner Interimsspielstätte Schillertheater angekommen ist. ... Es gibt Applaus auf offener Szene. Das geht den dreistündigen Abend über so weiter.
Volker Blech, Berliner Morgenpost
#KOBChicago
#Vaudeville
#Musical
29. Mai 2023
»Eine schöne Idee, dem großartigen Aryeh Nussbaum Cohen nach dem Schlusschor noch ein Lied von Herbert Howells anzuvertrauen... Es zeigt Cohen als einen Altus von einzigartigem Schmelz... Rupert Charlesworths Tenorstimme verbindet Klarheit und Unbedingtheit zu einer sprechenden vokalen Geste. Ebenso leuchtet aus Nadja Mchantafs Sopran die reine und einfache Zuneigung der Michal zu David... Dazu kommt ein fantastisch wendiger, klein besetzter, aber wunderbar präsenter Chor, den David Cavelius im Sinne bester britischer Chöre einstudiert hat. Seine Leistung im letzten Bild mit einzeln verlöschenden Einsätzen, der ergreifenden Klage und dem Aufschwung zum Jubelchor formt eine der eindrucksvollsten Chorszenen, die man in den letzten Jahren in Berliner Opernhäusern hören konnte.«
Händels »Saul«: Eine der eindrucksvollsten Chorszenen der letzten Jahre
Peter Uehling, Berliner Zeitung
Peter Uehling, Berliner Zeitung
#KOBSaul
28. Mai 2023
»Ranisch erzählt die Geschichte erfrischend neu ... am Ende stürmischer Beifall für alle. Für Dirigent David Bates und sein furioses Orchester. Beifall für den Chor und die allesamt stimmgewaltigen Solisten. Beifall auch für den Regisseur, der künftig weiter am Haus arbeiten wird. Ein Riesen-Erfolg, um in der Bildsprache zu bleiben.«
Komische Oper: Vor dem Umzug noch ein Highlight — mit »Saul«
Peter Zander, Berliner Morgenpost
Peter Zander, Berliner Morgenpost
#KOBSaul