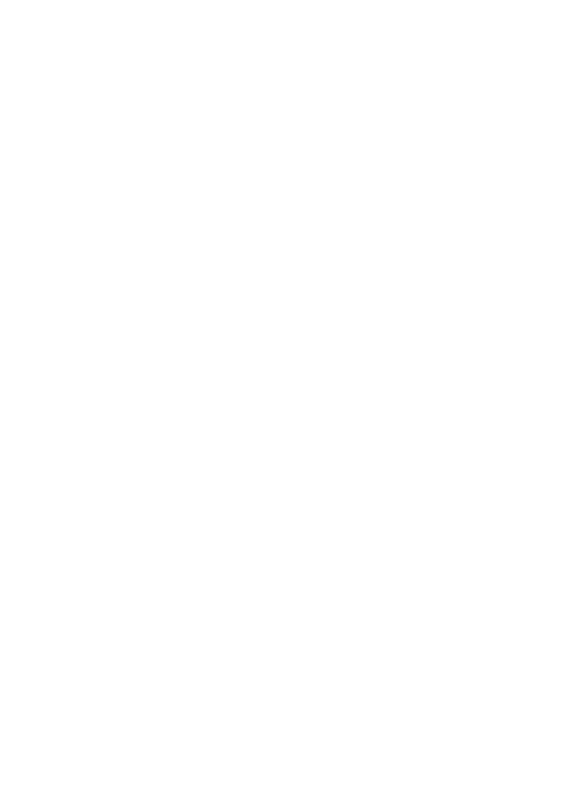© Jan Windszus Photography
Der Tod ist nicht verhandelbar
Regisseur Barrie Kosky über das Leben der Bohème, »messy love« und die kosmische Dimension der Wohnzimmer
Sie inszenieren eine der bekanntesten Opern der Welt …
Barrie Kosky: … die jede Menge Herausforderungen bereithält. Die erste betrifft die Konzeptionsphase, die zweite dann die Probenarbeit. Bei der Konzeption erging es mir mit La Bohème ähnlich wie mit Mozarts Zauberflöte oder Georges Bizets Carmen. Man muss sich fragen: Was will ich nicht? Ich beginne ungern derart negativ und ausschließend, aber bei solchen Stücken – die so viel Bedeutung angesammelt haben – ist dieses Verfahren sinnvoll. Und dann gilt es wie immer, mit der Musik zu beginnen: Was ist das? Diese unglaubliche, leicht dissonant gefärbte Einleitung des Stückes? Mir scheint, da tritt einer die Tür zum 20. Jahrhundert weit auf …
La Bohème entstand im Fin de Siècle, am Ende des 19. Jahrhunderts …
Barrie Kosky: Aber Puccini steht mit beiden Beinen im 20. Jahrhundert, auch wenn die Uraufführung 1896 stattfand. Uns ist die Eröffnung dieser Oper vertraut, aber damals war ein solcher Beginn absolut neu! Für mich besteht eine viel größere Verbindung von La Bohème zu einem Werk wie Alban Bergs Wozzeck als etwa zum Œuvre Verdis. Natürlich, die Themen sind völlig verschieden. Aber Wozzeck war ein Novum, in musikalischer Hinsicht, was die Struktur des Stückes betrifft, und auch in der Wahl des Sujets. Tatsächlich sehe ich in La Bohème eine ähnliche Qualität radikaler Neuerung. La Bohème hat einen »prophetischen« Zug, es lebt von einer emotionalen Fülle und Komplexität, die man am 19. Jahrhundert manchmal vermisst. Die gab es im Barock und bis zu Mozart, dann aber geriet sie in den Hintergrund. Puccinis Interesse für Menschen ist eher dem Mozarts in Nozze di Figaro oder dem Bizets in Carmen vergleichbar. Sein Bedürfnis nach »Realismus« in der Sprache teilt er wiederum mit Leoš Janáček. Wie Janáček suchte Puccini in seiner Musik stets nach größter Nähe zum Rhythmus und zu den Mustern der Alltagssprache. Beide richteten ihre gesamte Komposition danach aus. Genialerweise schrieben sie aber keinen Klangteppich, über dem die Sänger sprechen oder rezitieren, sondern fügten Text und Musik zu einem untrennbaren Ganzen zusammen. Das Ergebnis ist eine Zwischenwelt: zwischen Realität und Traum, Künstlichkeit und organischer Natürlichkeit.
Barrie Kosky: … die jede Menge Herausforderungen bereithält. Die erste betrifft die Konzeptionsphase, die zweite dann die Probenarbeit. Bei der Konzeption erging es mir mit La Bohème ähnlich wie mit Mozarts Zauberflöte oder Georges Bizets Carmen. Man muss sich fragen: Was will ich nicht? Ich beginne ungern derart negativ und ausschließend, aber bei solchen Stücken – die so viel Bedeutung angesammelt haben – ist dieses Verfahren sinnvoll. Und dann gilt es wie immer, mit der Musik zu beginnen: Was ist das? Diese unglaubliche, leicht dissonant gefärbte Einleitung des Stückes? Mir scheint, da tritt einer die Tür zum 20. Jahrhundert weit auf …
La Bohème entstand im Fin de Siècle, am Ende des 19. Jahrhunderts …
Barrie Kosky: Aber Puccini steht mit beiden Beinen im 20. Jahrhundert, auch wenn die Uraufführung 1896 stattfand. Uns ist die Eröffnung dieser Oper vertraut, aber damals war ein solcher Beginn absolut neu! Für mich besteht eine viel größere Verbindung von La Bohème zu einem Werk wie Alban Bergs Wozzeck als etwa zum Œuvre Verdis. Natürlich, die Themen sind völlig verschieden. Aber Wozzeck war ein Novum, in musikalischer Hinsicht, was die Struktur des Stückes betrifft, und auch in der Wahl des Sujets. Tatsächlich sehe ich in La Bohème eine ähnliche Qualität radikaler Neuerung. La Bohème hat einen »prophetischen« Zug, es lebt von einer emotionalen Fülle und Komplexität, die man am 19. Jahrhundert manchmal vermisst. Die gab es im Barock und bis zu Mozart, dann aber geriet sie in den Hintergrund. Puccinis Interesse für Menschen ist eher dem Mozarts in Nozze di Figaro oder dem Bizets in Carmen vergleichbar. Sein Bedürfnis nach »Realismus« in der Sprache teilt er wiederum mit Leoš Janáček. Wie Janáček suchte Puccini in seiner Musik stets nach größter Nähe zum Rhythmus und zu den Mustern der Alltagssprache. Beide richteten ihre gesamte Komposition danach aus. Genialerweise schrieben sie aber keinen Klangteppich, über dem die Sänger sprechen oder rezitieren, sondern fügten Text und Musik zu einem untrennbaren Ganzen zusammen. Das Ergebnis ist eine Zwischenwelt: zwischen Realität und Traum, Künstlichkeit und organischer Natürlichkeit.
Zurück zu den Herausforderungen …
Barrie Kosky: Die zweite besteht darin, dass man etwa zwei Dutzend Bohème-Inszenierungen aus dem Bewusstsein verdrängen muss. Das halte ich für notwendig, um die Klischees und Gewohnheiten, die sich über die Jahrzehnte im Umgang mit dem Stück eingeschliffen haben, loszuwerden. Denn man muss dem Publikum die Frage beantworten: »Worum geht es?« Manche Leute antworten darauf: »Es geht um sentimentalen Nonsens.« Das halte ich für geradezu snobistisch, es ist letztlich aber auch nur eine Folge der mit diesem Stück verwachsenen Klischees.
Und worum geht es?
Barrie Kosky: Um den Tod. Auf die joie de vivre der Jungs im ersten Bild, auf das metropolitane Panorama im Café Momus und das Klein-Klein des Liebesalltags folgt schließlich: der Tod. Und diese Erfahrung trifft diese jungen Menschen zum ersten Mal in ihrem Leben – das ist ein schockierender Einbruch der Endlichkeit. Warum ist dieses Stück so ungemein erfolgreich, über Generationen hinweg? Weil die »erste Liebe« zwischen Rodolfo und Mimì die Menschen so berührt? Ich möchte behaupten: Beide hatten schon vorher Liebesbeziehungen und sexuelle Kontakte – genau das macht sie interessant. Das ist keine Romeo und Julia-Geschichte, es geht um eine Frau, die krank ist und stirbt. Das alles ist sehr konkret, und der Schluss ist so ergreifend, weil wir Zeugen dieser ersten »Todeserfahrung« werden. Und ein jeder erinnert sich an diesen Moment, in dem das Bewusstsein der Sterblichkeit und des Todes erstmals ins eigene Leben trat – weil etwa jemand aus dem näheren Familien- oder Freundeskreis starb.
Barrie Kosky: Die zweite besteht darin, dass man etwa zwei Dutzend Bohème-Inszenierungen aus dem Bewusstsein verdrängen muss. Das halte ich für notwendig, um die Klischees und Gewohnheiten, die sich über die Jahrzehnte im Umgang mit dem Stück eingeschliffen haben, loszuwerden. Denn man muss dem Publikum die Frage beantworten: »Worum geht es?« Manche Leute antworten darauf: »Es geht um sentimentalen Nonsens.« Das halte ich für geradezu snobistisch, es ist letztlich aber auch nur eine Folge der mit diesem Stück verwachsenen Klischees.
Und worum geht es?
Barrie Kosky: Um den Tod. Auf die joie de vivre der Jungs im ersten Bild, auf das metropolitane Panorama im Café Momus und das Klein-Klein des Liebesalltags folgt schließlich: der Tod. Und diese Erfahrung trifft diese jungen Menschen zum ersten Mal in ihrem Leben – das ist ein schockierender Einbruch der Endlichkeit. Warum ist dieses Stück so ungemein erfolgreich, über Generationen hinweg? Weil die »erste Liebe« zwischen Rodolfo und Mimì die Menschen so berührt? Ich möchte behaupten: Beide hatten schon vorher Liebesbeziehungen und sexuelle Kontakte – genau das macht sie interessant. Das ist keine Romeo und Julia-Geschichte, es geht um eine Frau, die krank ist und stirbt. Das alles ist sehr konkret, und der Schluss ist so ergreifend, weil wir Zeugen dieser ersten »Todeserfahrung« werden. Und ein jeder erinnert sich an diesen Moment, in dem das Bewusstsein der Sterblichkeit und des Todes erstmals ins eigene Leben trat – weil etwa jemand aus dem näheren Familien- oder Freundeskreis starb.

© Jan Windszus Photography
Dann fragt man nach Liebe …
Barrie Kosky: Natürlich – das ist von Puccini und seinen Librettisten sehr genial gestaltet: Es geht um den Tod, aber verhandelt wird die Liebe, denn der Tod ist nicht verhandelbar. Puccini aber macht keine »Werbung« für Liebe, für romantische Liebe. Wenn überhaupt, wirbt er für die Realität der Liebe. Darin ist er uns Menschen des 20. und 21. Jahrhunderts sehr verständlich und nah – denn wie ist die Liebe in Puccinis Augen? Sie ist »messy«, also »chaotisch«! Liebe ist bei Puccini sehr häufig »messy« – so auch in Madama Butterfly, Trittico und Manon Lescaut. Darin steht er Autoren wie Tschechow, Ibsen oder Strindberg viel näher als Verdi oder Wagner und deren sakralisierenden Liebeskonzeptionen. Die möchte ich nicht kritisieren, nur muss man den Unterschied sehen: Bei Verdi sind Gefühle noch abstrakter gefasst. Dem entspricht die Form, der Fluss der Zeit wird mit den Arien und Duetten usw. minutenlang unterbrochen. Puccini dagegen schreibt konkret. Er interessiert sich auch nicht für Königinnen und Heldenmythen, er sagt vielmehr: »Mich interessiert die Politik der Wohnzimmer, die Erotik der Wohnzimmer! Denn diese Mikrokosmen führen von sich aus eine poetische, kosmische Dimension mit sich – sie müssen dafür nicht poetisch oder kosmisch sein!« Von Puccini lernen wir, dass die Liebe nicht wie ein Mies-van-der-Rohe-Gebäude ist, sondern vielmehr wie ein unaufgeräumtes Schlafzimmer.
Die Poesie des Alltags …
Barrie Kosky: … die man spielen muss! Und hier beginnen die Herausforderungen der Proben. Denn Puccini hat ein Stück verfasst, bei dem die Regieanweisungen komponiert sind. Jemand sagt: »Gib mir das Glas!«, und dann folgen drei, vier Takte für den Vorgang, denn er weiß: Der Sänger muss aufstehen, zum Tisch gehen, das Glas nehmen usw. All dies kann man in der Musik hören. Ich kenne keinen anderen wichtigen Komponisten, der wie Puccini regelrechte Requisitenchoreographien komponiert hat. Daher habe ich mein Team aufgefordert: »Lasst uns dieses 1:1-Prinzip nicht ignorieren, sondern im Gegenteil: feiern!« Man kann das Stück nicht auf einer leeren Bühne spielen, sondern benötigt konkrete Orte und Gegenstände.
Allerdings ist Paris in Ihrer Regie nicht »konkret« inszeniert …
Barrie Kosky: Meinen Sie? Wieder ist die Frage: Wie entkommen wir dem Klischee der Märsche und Weihnachtsumzüge? Unsere Interpretation geht vom Ort, dem Café Momus aus. In der griechischen Mythologie gilt der Gott Momos – übrigens ein Bruder von Thanatos, dem Gott des Todes – als Kritiker, als Tadler, als Narr, als ein Element zwischen den Genres und Formen. In La Bohème ist er Namensgeber für den Ort des Rausches, bedeutet also auch das dionysische Prinzip. Dementsprechend haben wir Paris und die Chiffre Momus als ein Gefühl oder einen Geisteszustand interpretiert. Es geht in diesem Panoptikum um Paris als eine rauschhafte, exzessive, surreale, freudige und auch tragische Welt, in der die vielen Orte und Lokalitäten der Stadt verdichtet werden.
Barrie Kosky: Natürlich – das ist von Puccini und seinen Librettisten sehr genial gestaltet: Es geht um den Tod, aber verhandelt wird die Liebe, denn der Tod ist nicht verhandelbar. Puccini aber macht keine »Werbung« für Liebe, für romantische Liebe. Wenn überhaupt, wirbt er für die Realität der Liebe. Darin ist er uns Menschen des 20. und 21. Jahrhunderts sehr verständlich und nah – denn wie ist die Liebe in Puccinis Augen? Sie ist »messy«, also »chaotisch«! Liebe ist bei Puccini sehr häufig »messy« – so auch in Madama Butterfly, Trittico und Manon Lescaut. Darin steht er Autoren wie Tschechow, Ibsen oder Strindberg viel näher als Verdi oder Wagner und deren sakralisierenden Liebeskonzeptionen. Die möchte ich nicht kritisieren, nur muss man den Unterschied sehen: Bei Verdi sind Gefühle noch abstrakter gefasst. Dem entspricht die Form, der Fluss der Zeit wird mit den Arien und Duetten usw. minutenlang unterbrochen. Puccini dagegen schreibt konkret. Er interessiert sich auch nicht für Königinnen und Heldenmythen, er sagt vielmehr: »Mich interessiert die Politik der Wohnzimmer, die Erotik der Wohnzimmer! Denn diese Mikrokosmen führen von sich aus eine poetische, kosmische Dimension mit sich – sie müssen dafür nicht poetisch oder kosmisch sein!« Von Puccini lernen wir, dass die Liebe nicht wie ein Mies-van-der-Rohe-Gebäude ist, sondern vielmehr wie ein unaufgeräumtes Schlafzimmer.
Die Poesie des Alltags …
Barrie Kosky: … die man spielen muss! Und hier beginnen die Herausforderungen der Proben. Denn Puccini hat ein Stück verfasst, bei dem die Regieanweisungen komponiert sind. Jemand sagt: »Gib mir das Glas!«, und dann folgen drei, vier Takte für den Vorgang, denn er weiß: Der Sänger muss aufstehen, zum Tisch gehen, das Glas nehmen usw. All dies kann man in der Musik hören. Ich kenne keinen anderen wichtigen Komponisten, der wie Puccini regelrechte Requisitenchoreographien komponiert hat. Daher habe ich mein Team aufgefordert: »Lasst uns dieses 1:1-Prinzip nicht ignorieren, sondern im Gegenteil: feiern!« Man kann das Stück nicht auf einer leeren Bühne spielen, sondern benötigt konkrete Orte und Gegenstände.
Allerdings ist Paris in Ihrer Regie nicht »konkret« inszeniert …
Barrie Kosky: Meinen Sie? Wieder ist die Frage: Wie entkommen wir dem Klischee der Märsche und Weihnachtsumzüge? Unsere Interpretation geht vom Ort, dem Café Momus aus. In der griechischen Mythologie gilt der Gott Momos – übrigens ein Bruder von Thanatos, dem Gott des Todes – als Kritiker, als Tadler, als Narr, als ein Element zwischen den Genres und Formen. In La Bohème ist er Namensgeber für den Ort des Rausches, bedeutet also auch das dionysische Prinzip. Dementsprechend haben wir Paris und die Chiffre Momus als ein Gefühl oder einen Geisteszustand interpretiert. Es geht in diesem Panoptikum um Paris als eine rauschhafte, exzessive, surreale, freudige und auch tragische Welt, in der die vielen Orte und Lokalitäten der Stadt verdichtet werden.

© Jan Windszus Photography
Auch das Bühnenbild ist von den Entwicklungen des 19. Jahrhunderts inspiriert …
Barrie Kosky: Der Grundraum besteht aus vergrößerten Fotoplatten, die mit der Erfindung der Daguerreotypie in die Welt kamen. Diese Technik ist der Vorläufer der Fotografie und bemerkenswerterweise sind bereits zu diesem frühen Zeitpunkt sehr hochwertige Bilder entstanden – von denen wir viele noch heute betrachten können. Bevor auf Film belichtet wurde, nutzte man Fotoplatten, die aufgrund der verwendeten Chemikalien mit der Zeit verblassten – dieses Verlöschen der bildlichen Erinnerung, die unmittelbar sichtbare Vergänglichkeit, haben wir aufgegriffen. In unserer Inszenierung ist der Maler Marcello ein früher Fotokünstler, der seine Modelle vor Prospekten postiert. Die Bohémiens waren ja damit beschäftigt, neue Kunst zu schaffen – und man kann die Revolution der Bilderwelt durch Daguerres Erfindung gar nicht hoch genug einschätzen. Heute sind fotografische Bilder ganz selbstverständlich, wir nehmen sie jeden Tag mit unseren Mobiltelefonen auf. Aber man stelle sich die Wirkung vor, als im 19. Jahrhundert plötzlich Abbilder von Menschen produziert wurden, die auch das kleinste Detail der Wirklichkeit wiedergaben – und dann vielleicht noch einen bereits Verstorbenen zeigten! Nicht von ungefähr gibt es Kulturen, in denen die Menschen es ablehnen, fotografiert zu werden. Etwa weil sie fürchten, ihre Seele zu verlieren. Der Einzug der Fotografie in die Gesellschaft bedeutete eine ungeheuerliche Revolution im Verhältnis der Menschen zur Lebenswirklichkeit, zur Zeit und zum Tod!
Was ist ein Bohémien?
Barrie Kosky: Es ist eine Lebensweise, die es schon vor Murger oder Puccini und an anderen Orten als Paris gab. Im 19. Jahrhundert allerdings wurde daraus ein Lebensstil, der in den kulturellen Betrieb der Gesellschaft mehr und mehr eingebunden war. Junge Menschen begannen ihr Leben mit einer Phase des Experiments, eventuell studierten sie in dieser Zeit oder probierten sich in künstlerischen Berufen aus und hielten sich mit allen möglichen Tätigkeiten über Wasser. Mir ist sehr wichtig, dass man diese Figuren ernst nimmt. Rodolfo und Marcello mögen eventuell einen bürgerlichen Hintergrund haben, doch in dem Augenblick, in dem wir sie erleben, haben sie kein Geld. Aber sie sind talentiert. Das sind werdende Künstler! Für die Bohémiens des Stückes ist die Erfahrung von Mimìs Tod jenes einschneidende Ereignis, das aus Talenten Künstler mit Lebenserfahrung werden lässt.
Barrie Kosky: Der Grundraum besteht aus vergrößerten Fotoplatten, die mit der Erfindung der Daguerreotypie in die Welt kamen. Diese Technik ist der Vorläufer der Fotografie und bemerkenswerterweise sind bereits zu diesem frühen Zeitpunkt sehr hochwertige Bilder entstanden – von denen wir viele noch heute betrachten können. Bevor auf Film belichtet wurde, nutzte man Fotoplatten, die aufgrund der verwendeten Chemikalien mit der Zeit verblassten – dieses Verlöschen der bildlichen Erinnerung, die unmittelbar sichtbare Vergänglichkeit, haben wir aufgegriffen. In unserer Inszenierung ist der Maler Marcello ein früher Fotokünstler, der seine Modelle vor Prospekten postiert. Die Bohémiens waren ja damit beschäftigt, neue Kunst zu schaffen – und man kann die Revolution der Bilderwelt durch Daguerres Erfindung gar nicht hoch genug einschätzen. Heute sind fotografische Bilder ganz selbstverständlich, wir nehmen sie jeden Tag mit unseren Mobiltelefonen auf. Aber man stelle sich die Wirkung vor, als im 19. Jahrhundert plötzlich Abbilder von Menschen produziert wurden, die auch das kleinste Detail der Wirklichkeit wiedergaben – und dann vielleicht noch einen bereits Verstorbenen zeigten! Nicht von ungefähr gibt es Kulturen, in denen die Menschen es ablehnen, fotografiert zu werden. Etwa weil sie fürchten, ihre Seele zu verlieren. Der Einzug der Fotografie in die Gesellschaft bedeutete eine ungeheuerliche Revolution im Verhältnis der Menschen zur Lebenswirklichkeit, zur Zeit und zum Tod!
Was ist ein Bohémien?
Barrie Kosky: Es ist eine Lebensweise, die es schon vor Murger oder Puccini und an anderen Orten als Paris gab. Im 19. Jahrhundert allerdings wurde daraus ein Lebensstil, der in den kulturellen Betrieb der Gesellschaft mehr und mehr eingebunden war. Junge Menschen begannen ihr Leben mit einer Phase des Experiments, eventuell studierten sie in dieser Zeit oder probierten sich in künstlerischen Berufen aus und hielten sich mit allen möglichen Tätigkeiten über Wasser. Mir ist sehr wichtig, dass man diese Figuren ernst nimmt. Rodolfo und Marcello mögen eventuell einen bürgerlichen Hintergrund haben, doch in dem Augenblick, in dem wir sie erleben, haben sie kein Geld. Aber sie sind talentiert. Das sind werdende Künstler! Für die Bohémiens des Stückes ist die Erfahrung von Mimìs Tod jenes einschneidende Ereignis, das aus Talenten Künstler mit Lebenserfahrung werden lässt.
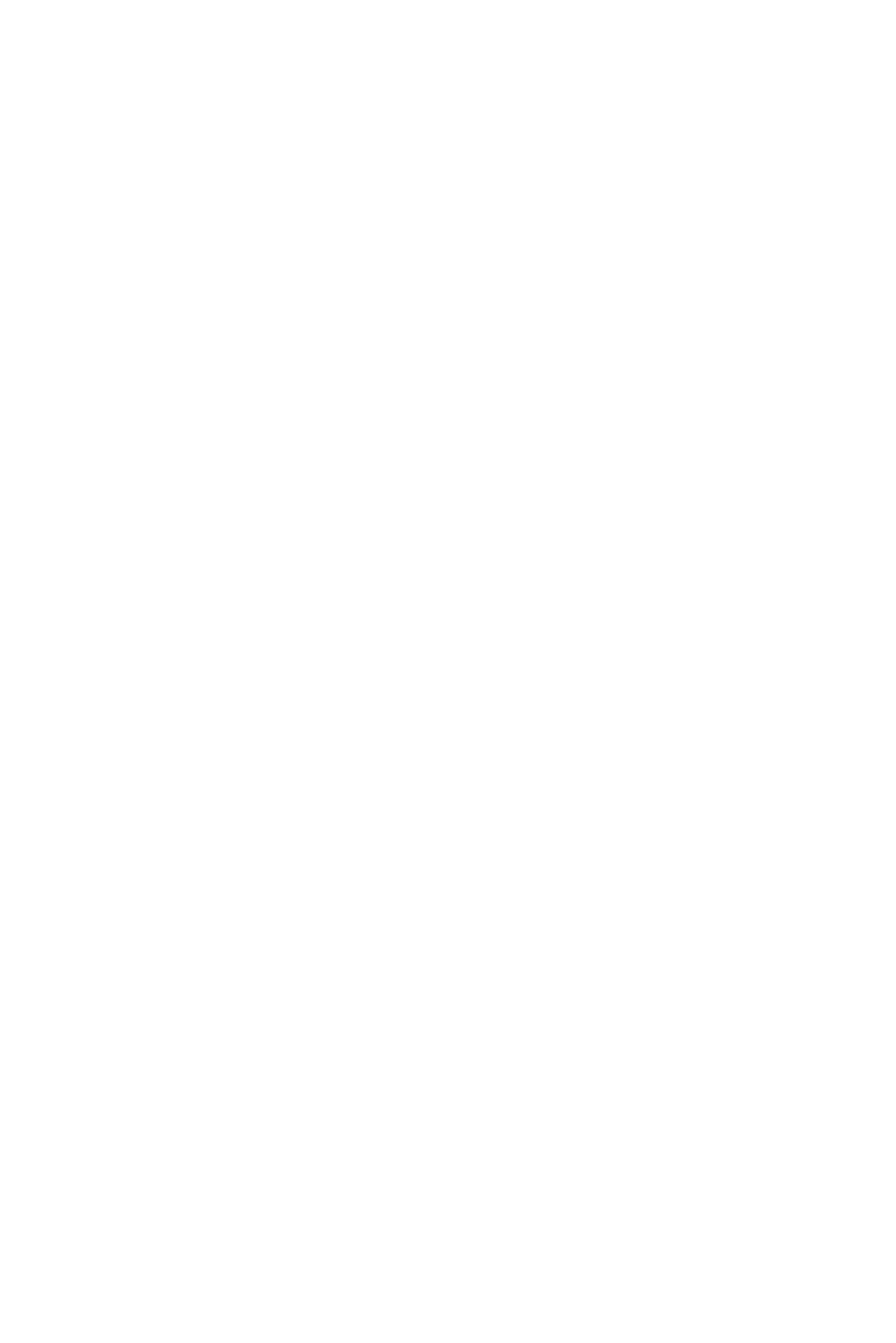
© Jan Windszus Photography
Welche Erfahrung macht Mimì im Kreis dieser Bohémiens?
Barrie Kosky: Die Jungs, die sie trifft, sind sehr verschieden: Marcello ist ein jugendlicher Zyniker. Rodolfo wird seinerseits oft als romantischer Held oder Verführer inszeniert – das finde ich etwas banal. Mir gefällt die Idee, dass Rodolfo Mimì bei ihrer ersten Begegnung etwas gesteht, seine inneren, privaten Gedanken und Ideen. Er öffnet ihr sein Herz. Ich hoffe sehr, dass es uns gelingt, einen Rodolfo zu gestalten, der etwas unsicherer, fragiler und auch impulsiver ist. Er entstammt nicht der Don-Giovanni-Schule und ist auch nicht der Baby-Cavaradossi, der später auf Tosca treffen wird. Rodolfo ist jung und daher auch unsicher. Im dritten Bild wird dies ganz deutlich: Er weiß nicht recht, was er will. Daher rührt auch seine Frustration. Was Mimì betrifft, möchte ich sie nicht als hustende, passive Jungfrau verstanden wissen – sie ist eine selbstbewusste junge Dame, die mit diesen Kerlen eine gute Zeit hat. Im zweiten Bild genießen sie gemeinsam das High-Life, die Zeit ihres Lebens, und im dritten Bild teilt sie Rodolfos Verwirrung. Wichtig für die Figur Mimì ist die Weise, in der Puccini ihren Tod gestaltet. Sie opfert sich nicht für einen Mann, wie bei Wagner, sondern stirbt einen völlig unspektakulären Tod. Keine Arie, kein langes Leiden. Das ist sehr unüblich, aber genial.
Der Aspekt der Jugend in diesem Stück wird oft unterschätzt …
Barrie Kosky: Aber er ist von zentraler Bedeutung! Das betrifft auch die Kompositionsweise: Bei Puccini stimmt jede Note – nichts ist zu viel oder zu wenig und alles ist konkret und direkt. Diese jungen Menschen sagen, was ihnen in den Sinn kommt. Da gibt es keine Masken und Versteckspiele. Was selten erwähnt wird: Es gibt auch keine Eltern! Damit meine ich, dass diese Figuren alle in etwa im gleichen Alter sind. Es gibt keine Könige, keine Familien, keinen Hof. Sie leben gemeinsam in ihrer Welt – und plötzlich steht der Tod in der Tür.
Barrie Kosky: Die Jungs, die sie trifft, sind sehr verschieden: Marcello ist ein jugendlicher Zyniker. Rodolfo wird seinerseits oft als romantischer Held oder Verführer inszeniert – das finde ich etwas banal. Mir gefällt die Idee, dass Rodolfo Mimì bei ihrer ersten Begegnung etwas gesteht, seine inneren, privaten Gedanken und Ideen. Er öffnet ihr sein Herz. Ich hoffe sehr, dass es uns gelingt, einen Rodolfo zu gestalten, der etwas unsicherer, fragiler und auch impulsiver ist. Er entstammt nicht der Don-Giovanni-Schule und ist auch nicht der Baby-Cavaradossi, der später auf Tosca treffen wird. Rodolfo ist jung und daher auch unsicher. Im dritten Bild wird dies ganz deutlich: Er weiß nicht recht, was er will. Daher rührt auch seine Frustration. Was Mimì betrifft, möchte ich sie nicht als hustende, passive Jungfrau verstanden wissen – sie ist eine selbstbewusste junge Dame, die mit diesen Kerlen eine gute Zeit hat. Im zweiten Bild genießen sie gemeinsam das High-Life, die Zeit ihres Lebens, und im dritten Bild teilt sie Rodolfos Verwirrung. Wichtig für die Figur Mimì ist die Weise, in der Puccini ihren Tod gestaltet. Sie opfert sich nicht für einen Mann, wie bei Wagner, sondern stirbt einen völlig unspektakulären Tod. Keine Arie, kein langes Leiden. Das ist sehr unüblich, aber genial.
Der Aspekt der Jugend in diesem Stück wird oft unterschätzt …
Barrie Kosky: Aber er ist von zentraler Bedeutung! Das betrifft auch die Kompositionsweise: Bei Puccini stimmt jede Note – nichts ist zu viel oder zu wenig und alles ist konkret und direkt. Diese jungen Menschen sagen, was ihnen in den Sinn kommt. Da gibt es keine Masken und Versteckspiele. Was selten erwähnt wird: Es gibt auch keine Eltern! Damit meine ich, dass diese Figuren alle in etwa im gleichen Alter sind. Es gibt keine Könige, keine Familien, keinen Hof. Sie leben gemeinsam in ihrer Welt – und plötzlich steht der Tod in der Tür.
Mehr dazu
15. März 2024
Puccini predigt nichts!
Dirigent Jordan de Souza über Paris, die kleinen Dinge in der Musik bei La Bohème
#KOBBoheme
Interview
14. März 2024
»Ich sehe einen Siegeszug dieser Oper voraus«
Von Bohèmiens und Bürgern, Barrikaden und Bordellen in Puccinis La Bohème
#KOBBoheme
Einführung