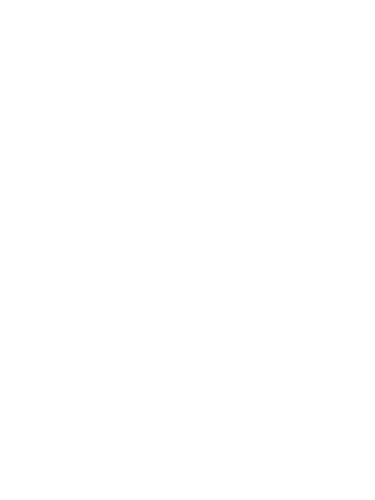© Iko Freese / drama-berlin.de
»Du bist in Berlin, Baby!«
Barrie Kosky und Adam Benzwi über Humor, Liebesflöten und das perfekte Timing in ihrer Inszenierung Die Perlen der Cleopatra
Nach dem Erfolg von Eine Frau, die weiß, was sie will! haben Sie sich erneut für eine Operette von Oscar Straus entschieden, die Wahl fiel auf Die Perlen der Cleopatra ...
Barrie Kosky: Wichtig für solche programmatischen Entscheidungen ist zunächst und vor allem die musikalische Qualität. Oscar Straus’ Perlen der Cleopatra halte ich ebenso wie Eine Frau, die weiß, was sie will! für ein Meisterwerk. Straus kombiniert hier Wiener Operettentradition und den Jazz der 1920er Jahre, der sich fundamental von den Entwicklungen des Jazz der 30er Jahre unterscheidet. Er schuf keine Wiener Operette – obwohl dieser Bezug sehr dominant ist –, die Partitur atmet schon ganz »Berliner Luft«. Und das Werk ist angereichert um Orientalismen, die Straus der Opern- und Ballettmusik des 19. Jahrhunderts entnimmt, durchaus parodistisch und mit satirischem Blick, zum Beispiel auf Richard Strauss’ Salome.
Auch dort steht eine exotische und erotische Frauenfigur im Zentrum ...
Barrie Kosky: Das ist ein weiterer entscheidender Punkt bei der Stückwahl: Mit welchen Künstlern arbeiten wir? Die Perlen der Cleopatra wurde explizit für Fritzi Massary geschaffen. Mit Dagmar Manzel, die nach Eine Frau nun in ihrer zweiten »Massary-Partie« auf der Bühne der Komischen Oper Berlin zu erleben ist, haben wir die ideale, in meinen Augen einzig mögliche, Besetzung gefunden. Sie ist eine seelenverwandte Schwester der Massary und hat zugleich in keinem Moment die Absicht, wie Fritzi Massary zu singen oder zu spielen. Zu guter Letzt war das Stück seit seiner Berlin-Premiere 1924 fast nicht zu erleben. Das heißt, wir haben es nach über 90 Jahren mit einer kleinen Wiederentdeckung des Werks zu tun. Fast noch deutlicher als Paul Abrahams Ball im Savoy steht es für den Übergang der Wiener zur Berliner Operette.
Barrie Kosky: Wichtig für solche programmatischen Entscheidungen ist zunächst und vor allem die musikalische Qualität. Oscar Straus’ Perlen der Cleopatra halte ich ebenso wie Eine Frau, die weiß, was sie will! für ein Meisterwerk. Straus kombiniert hier Wiener Operettentradition und den Jazz der 1920er Jahre, der sich fundamental von den Entwicklungen des Jazz der 30er Jahre unterscheidet. Er schuf keine Wiener Operette – obwohl dieser Bezug sehr dominant ist –, die Partitur atmet schon ganz »Berliner Luft«. Und das Werk ist angereichert um Orientalismen, die Straus der Opern- und Ballettmusik des 19. Jahrhunderts entnimmt, durchaus parodistisch und mit satirischem Blick, zum Beispiel auf Richard Strauss’ Salome.
Auch dort steht eine exotische und erotische Frauenfigur im Zentrum ...
Barrie Kosky: Das ist ein weiterer entscheidender Punkt bei der Stückwahl: Mit welchen Künstlern arbeiten wir? Die Perlen der Cleopatra wurde explizit für Fritzi Massary geschaffen. Mit Dagmar Manzel, die nach Eine Frau nun in ihrer zweiten »Massary-Partie« auf der Bühne der Komischen Oper Berlin zu erleben ist, haben wir die ideale, in meinen Augen einzig mögliche, Besetzung gefunden. Sie ist eine seelenverwandte Schwester der Massary und hat zugleich in keinem Moment die Absicht, wie Fritzi Massary zu singen oder zu spielen. Zu guter Letzt war das Stück seit seiner Berlin-Premiere 1924 fast nicht zu erleben. Das heißt, wir haben es nach über 90 Jahren mit einer kleinen Wiederentdeckung des Werks zu tun. Fast noch deutlicher als Paul Abrahams Ball im Savoy steht es für den Übergang der Wiener zur Berliner Operette.
Über einem Jahr lief die Arbeit an der Einrichtung der Partitur ...
Adam Benzwi: Bei einem derart doppeldeutigen Libretto besteht die Herausforderung darin, den Pointen mit feiner Leichtigkeit und Eleganz Raum zu geben. Dementsprechend ändere ich mitunter Tonarten, Pausen im Ablauf, den Rhythmus und auch die Orchestrierung. Diese habe ich teils reduziert, damit Humor und schlüpfrige Anspielungen auf leichte Weise wirken können.
Barrie Kosky: Es gibt eine Reihe sehr wichtiger Dinge im Prozess einer Operettenproduktion, derer sich die Öffentlichkeit – und so soll es natürlich sein – gar nicht bewusst ist: Diese Stücke verlangen, ähnlich wie Barockopern, geradezu nach einer Bearbeitung. Die Partituren von Barockopern und Operetten sind nur ein Skelett. Zu Monteverdis Zeit, im frühen 17. Jahrhundert, unterschied sich jede einzelne Aufführung eines Werks von der vorhergehenden. Die Orchestrierung wurde geändert, eine andere Tonlage gewählt, es gab Adaptionen, Striche und Improvisationen der Sänger. Dies bedeutet »Authentizität« im Barock, und in der modernen Operette ist es nicht anders. Adam und ich versuchen, diese Authentizität in die Klangwelt zu implementieren. Das Werk klingt nach den 1920er und 30er Jahren. Zugleich ist vollkommen klar, dass wir eine Produktion im Berlin des 21. Jahrhunderts präsentieren. Das Stück muss heute musikalisch-dramatisch funktionieren.
Adam Benzwi: Bei einem derart doppeldeutigen Libretto besteht die Herausforderung darin, den Pointen mit feiner Leichtigkeit und Eleganz Raum zu geben. Dementsprechend ändere ich mitunter Tonarten, Pausen im Ablauf, den Rhythmus und auch die Orchestrierung. Diese habe ich teils reduziert, damit Humor und schlüpfrige Anspielungen auf leichte Weise wirken können.
Barrie Kosky: Es gibt eine Reihe sehr wichtiger Dinge im Prozess einer Operettenproduktion, derer sich die Öffentlichkeit – und so soll es natürlich sein – gar nicht bewusst ist: Diese Stücke verlangen, ähnlich wie Barockopern, geradezu nach einer Bearbeitung. Die Partituren von Barockopern und Operetten sind nur ein Skelett. Zu Monteverdis Zeit, im frühen 17. Jahrhundert, unterschied sich jede einzelne Aufführung eines Werks von der vorhergehenden. Die Orchestrierung wurde geändert, eine andere Tonlage gewählt, es gab Adaptionen, Striche und Improvisationen der Sänger. Dies bedeutet »Authentizität« im Barock, und in der modernen Operette ist es nicht anders. Adam und ich versuchen, diese Authentizität in die Klangwelt zu implementieren. Das Werk klingt nach den 1920er und 30er Jahren. Zugleich ist vollkommen klar, dass wir eine Produktion im Berlin des 21. Jahrhunderts präsentieren. Das Stück muss heute musikalisch-dramatisch funktionieren.

© Iko Freese / drama-berlin.de
Die Partitur ist also Material ...
Adam Benzwi: Ganz genau. Die Partie des Silvius haben wir derart angepasst, dass beispielsweise Dominik Köningers Passage »Cleopatra, Cleopatra, du Königin am Nil« für unsere heutigen Ohren erotisch klingt. Auch die Gesangslagen richten sich nach der Haltung der miteinander dialogisierenden Figuren. Beispielsweise habe ich Dominique Horwitz’ Partie des Pampylos an manchen Stellen tiefer gesetzt, weil er den jungen Beladonis belehrt. Die tiefe Lage unterstreicht die oberlehrerhafte Autorität. Die Sänger lasse ich zu Beginn der musikalischen Proben über den Text fabulieren und erarbeite auf diesem Weg Kernsätze. In der dritten Nummer, »Mir fehlt nichts als ein kleiner, ägyptischer Flirt.«, lautet dieser: »Ich habe alles, aber ich möchte mich verlieben.« Interessant ist daran, dass Cleopatra oberflächlich sagt: »Ich möchte Sex haben.« Doch lügt sie. In Wahrheit traut sie sich nicht, ihre Sehnsucht nach der großen Liebe zu formulieren.
Barrie Kosky: Diese Arbeit am Material ist sehr aufwendig und zugleich notwendig. Wir haben drei Akte auf zwei aufgeteilt. Dafür braucht es chirurgisches Gespür. Nicht, weil das Stück schlecht wäre, sondern weil sich die Rezeptionsbedingungen verändert haben. Am besten lässt sich das Problem an einer Frage verdeutlichen, die sich mir immer wieder stellt: Warum ist bei so vielen Operetten im dritten Akt buchstäblich »die Luft raus«? Auf einen fabelhaften ersten und zweiten folgt ein schwacher dritter Akt, mit ein oder zwei Arien und jeder Menge Dialogen. Das trifft auf Die Fledermaus zu, ähnlich bei der Lustigen Witwe und bei allen Offenbach- Operetten. Warum ist das so? – Weil die Theaterabende lang waren, die Leute hatten getrunken und wollten nach Hause. Die Aufführungen dauerten damals unter Umständen sechs Stunden, es gab zwei lange Pausen, in denen das Publikum die Bars und Restaurants im Theater oder seiner Umgebung besuchte.
Adam Benzwi: Ganz genau. Die Partie des Silvius haben wir derart angepasst, dass beispielsweise Dominik Köningers Passage »Cleopatra, Cleopatra, du Königin am Nil« für unsere heutigen Ohren erotisch klingt. Auch die Gesangslagen richten sich nach der Haltung der miteinander dialogisierenden Figuren. Beispielsweise habe ich Dominique Horwitz’ Partie des Pampylos an manchen Stellen tiefer gesetzt, weil er den jungen Beladonis belehrt. Die tiefe Lage unterstreicht die oberlehrerhafte Autorität. Die Sänger lasse ich zu Beginn der musikalischen Proben über den Text fabulieren und erarbeite auf diesem Weg Kernsätze. In der dritten Nummer, »Mir fehlt nichts als ein kleiner, ägyptischer Flirt.«, lautet dieser: »Ich habe alles, aber ich möchte mich verlieben.« Interessant ist daran, dass Cleopatra oberflächlich sagt: »Ich möchte Sex haben.« Doch lügt sie. In Wahrheit traut sie sich nicht, ihre Sehnsucht nach der großen Liebe zu formulieren.
Barrie Kosky: Diese Arbeit am Material ist sehr aufwendig und zugleich notwendig. Wir haben drei Akte auf zwei aufgeteilt. Dafür braucht es chirurgisches Gespür. Nicht, weil das Stück schlecht wäre, sondern weil sich die Rezeptionsbedingungen verändert haben. Am besten lässt sich das Problem an einer Frage verdeutlichen, die sich mir immer wieder stellt: Warum ist bei so vielen Operetten im dritten Akt buchstäblich »die Luft raus«? Auf einen fabelhaften ersten und zweiten folgt ein schwacher dritter Akt, mit ein oder zwei Arien und jeder Menge Dialogen. Das trifft auf Die Fledermaus zu, ähnlich bei der Lustigen Witwe und bei allen Offenbach- Operetten. Warum ist das so? – Weil die Theaterabende lang waren, die Leute hatten getrunken und wollten nach Hause. Die Aufführungen dauerten damals unter Umständen sechs Stunden, es gab zwei lange Pausen, in denen das Publikum die Bars und Restaurants im Theater oder seiner Umgebung besuchte.
Mir fehlt nichts als ein kleiner, ägyptischer Flirt. So ein Flirt, der was wert, der zum Dasein gehört. Ein pikantes, ein prickelndes: »Je ne sais quoi«, das verwirrt,
irritiert, wo man sagt: »C’est ma foi«Die Perlen der Cleopatra
Ein Großteil Ihrer Arbeit auf den Proben kreist um das richtige Timing …
Barrie Kosky: Damit steht und fällt der Abend. Am Timing muss auf jeder Probe gearbeitet werden. Das bedeutet komplexe Textarbeit. In gewisser Weise wird das Stück auf den Proben neu geschrieben. Daraus folgt, dass sowohl die Sänger als auch die musikalische Leitung in der Lage sein müssen, diese Bedürfnisse zu verstehen und in die Praxis umzusetzen. Unter den Operndirigenten hätten 99 Prozent keine Vorstellung, wie mit dieser theatralen Form umzugehen ist. Die Operette ist ein Fach und benötigt Fachleute.
Adam Benzwi: Ähnlich ist es mit der Diktion der Sänger. Interpunktion – das habe ich von Gisela May gelernt – muss musikalisch gedacht werden, damit die Pointe sitzt. Ich habe mich an der Arbeit Fritzi Massarys orientiert. Sie arbeitete sehr viel mit Sprechgesang. In dem Sinne sind wir »werktreu«: Die Melodie soll nicht genau so gesungen werden, wie sie notiert ist, sondern durch einen tollen Chanson-Sänger interpretiert werden. Ein gutes Beispiel dafür ist Cleopatras Erzählung nach ihrem Besuch im Tempel des Ptah: »In Memphis in dem heil’gen Tempel wohnt Radamos so jung.« Das wird normalerweise gesungen. Mit Dagmar Manzel haben wir dagegen diese spezielle Art von Sprechgesang erarbeitet.
Barrie Kosky: Damit steht und fällt der Abend. Am Timing muss auf jeder Probe gearbeitet werden. Das bedeutet komplexe Textarbeit. In gewisser Weise wird das Stück auf den Proben neu geschrieben. Daraus folgt, dass sowohl die Sänger als auch die musikalische Leitung in der Lage sein müssen, diese Bedürfnisse zu verstehen und in die Praxis umzusetzen. Unter den Operndirigenten hätten 99 Prozent keine Vorstellung, wie mit dieser theatralen Form umzugehen ist. Die Operette ist ein Fach und benötigt Fachleute.
Adam Benzwi: Ähnlich ist es mit der Diktion der Sänger. Interpunktion – das habe ich von Gisela May gelernt – muss musikalisch gedacht werden, damit die Pointe sitzt. Ich habe mich an der Arbeit Fritzi Massarys orientiert. Sie arbeitete sehr viel mit Sprechgesang. In dem Sinne sind wir »werktreu«: Die Melodie soll nicht genau so gesungen werden, wie sie notiert ist, sondern durch einen tollen Chanson-Sänger interpretiert werden. Ein gutes Beispiel dafür ist Cleopatras Erzählung nach ihrem Besuch im Tempel des Ptah: »In Memphis in dem heil’gen Tempel wohnt Radamos so jung.« Das wird normalerweise gesungen. Mit Dagmar Manzel haben wir dagegen diese spezielle Art von Sprechgesang erarbeitet.

© Iko Freese / drama-berlin.de
In Ihren konzeptionellen Überlegungen vorab spielten die liberalen Entwicklungen am Anfang des 20. Jahrhunderts eine Rolle, die sehr viel mit dem Genre zu tun haben.
Adam Benzwi: Ich verstehe »Ägypten« als ein Code-Wort für »Berlin«. Wenn es im Text heißt: »Hier in Ägypten ist die Welt so und so«, dann heißt das eigentlich: »Du bist in Berlin, Baby. Frauen können Sex haben, mit wem und wann sie wollen.«
Barrie Kosky: Straus und seine Librettisten Brammer und Grünwald haben mit Fritzi Massary ein Berlin-Stück geschaffen. Die Uraufführung in Wien war in gewisser Weise ein den Umständen geschuldetes Versehen. Für die Wiener Öffentlichkeit muss es – gelinde gesagt – befremdlich gewesen sein. Alle Anspielungen und Doppeldeutigkeiten beziehen sich auf Berlin. Und dann erst die lockere Gesamthaltung des Stücks: Diese Form sexueller Freiheit hat nichts mit der Wiener Operetten-Schule zu tun. Auf einer ganz anderen Ebene wird hier abermals die Radikalität der Operetten-Bühne sichtbar. Das beginnt bereits im 19. Jahrhundert: Offenbach konnte Dinge sagen und zeigen, die auf einer Opernbühne undenkbar gewesen wären. Im 20. Jahrhundert folgte das Kino als Ort radikaler Ideen. Im Bereich der darstellenden Künste aber war die Operette der Ort, weit mehr als das Sprechtheater, an dem ein enormer Wandel spürbar wurde: Das betraf das Frauenbild, die Rolle der Sexualität, Geschlechterpolitik, Rassen. Kurz: die Vermischung von afrikanisch-amerikanischem Jazz mit jüdischen Themen und weiblicher Emanzipation. Hat so etwas auf der Bühne des Deutschen Theaters oder der Staatsoper stattgefunden? Nein, all das passierte auf den Operetten-Bühnen – durch Satire und Unterhaltung.
Aufbruchsstimmung im Unterhaltungstheater …
Adam Benzwi: Man stelle sich vor: Carmen erschien 1875 – auf einer Opéra-comique-Bühne: das war revolutionär! Aber es würde Carmen ohne Offenbachs Schöne Helena nicht geben.Diese außergewöhnlichen Figuren tauchten alle zunächst auf Operetten- Bühnen auf, und töteten dort mit ihrem Humor, bevor sie in die sogenannte »ernsthafte Musik« einzogen. Musik, Tanz, Komik, Satire werden in der Operette vermischt – zu einem kosmopolitischen Cocktail. Daher erklärt sich auch der Hass der Nazis auf diese »undeutsche Vermischung«, die als eine »Gefahr für die nationale Identität ihrer Kultur« betrachtet wurde. Derlei Vorbehalte gibt es immer noch, nur dass es in unseren Tagen statt Juden Moslems sind, die man als Gefahr für die eigene kulturelle Identität betrachtet, statt Osteuropäern sind es Latinos.
Adam Benzwi: Ich verstehe »Ägypten« als ein Code-Wort für »Berlin«. Wenn es im Text heißt: »Hier in Ägypten ist die Welt so und so«, dann heißt das eigentlich: »Du bist in Berlin, Baby. Frauen können Sex haben, mit wem und wann sie wollen.«
Barrie Kosky: Straus und seine Librettisten Brammer und Grünwald haben mit Fritzi Massary ein Berlin-Stück geschaffen. Die Uraufführung in Wien war in gewisser Weise ein den Umständen geschuldetes Versehen. Für die Wiener Öffentlichkeit muss es – gelinde gesagt – befremdlich gewesen sein. Alle Anspielungen und Doppeldeutigkeiten beziehen sich auf Berlin. Und dann erst die lockere Gesamthaltung des Stücks: Diese Form sexueller Freiheit hat nichts mit der Wiener Operetten-Schule zu tun. Auf einer ganz anderen Ebene wird hier abermals die Radikalität der Operetten-Bühne sichtbar. Das beginnt bereits im 19. Jahrhundert: Offenbach konnte Dinge sagen und zeigen, die auf einer Opernbühne undenkbar gewesen wären. Im 20. Jahrhundert folgte das Kino als Ort radikaler Ideen. Im Bereich der darstellenden Künste aber war die Operette der Ort, weit mehr als das Sprechtheater, an dem ein enormer Wandel spürbar wurde: Das betraf das Frauenbild, die Rolle der Sexualität, Geschlechterpolitik, Rassen. Kurz: die Vermischung von afrikanisch-amerikanischem Jazz mit jüdischen Themen und weiblicher Emanzipation. Hat so etwas auf der Bühne des Deutschen Theaters oder der Staatsoper stattgefunden? Nein, all das passierte auf den Operetten-Bühnen – durch Satire und Unterhaltung.
Aufbruchsstimmung im Unterhaltungstheater …
Adam Benzwi: Man stelle sich vor: Carmen erschien 1875 – auf einer Opéra-comique-Bühne: das war revolutionär! Aber es würde Carmen ohne Offenbachs Schöne Helena nicht geben.Diese außergewöhnlichen Figuren tauchten alle zunächst auf Operetten- Bühnen auf, und töteten dort mit ihrem Humor, bevor sie in die sogenannte »ernsthafte Musik« einzogen. Musik, Tanz, Komik, Satire werden in der Operette vermischt – zu einem kosmopolitischen Cocktail. Daher erklärt sich auch der Hass der Nazis auf diese »undeutsche Vermischung«, die als eine »Gefahr für die nationale Identität ihrer Kultur« betrachtet wurde. Derlei Vorbehalte gibt es immer noch, nur dass es in unseren Tagen statt Juden Moslems sind, die man als Gefahr für die eigene kulturelle Identität betrachtet, statt Osteuropäern sind es Latinos.

© Iko Freese / drama-berlin.de
Die Perlen der Cleopatra sind aber auch ein Zeitzeugnis deutschsprachigen Humors ...
Barrie Kosky: Daher sind diese Stücke so außerordentlich interessant. Wir haben es mit einem Faden deutscher Kultur zu tun, der nie in seinem vollen Potential ausgesponnen wurde! Bedenken wir, dass der historische Raum, den wir hier abschreiten, gerade einmal 15 Jahre dauerte. Dann wurde dieser Faden abgeschnitten, und seine Energie verlagerte sich nach Amerika. Wenn die deutsche Kultur ein Körper wäre, dann wurden ihm buchstäblich die Beine herausgerissen. Und was in der Nachkriegszeit passierte, gerade auch mit Die Perlen der Cleopatra, ist ein Desaster.
Adam Benzwi: Ja, unglaublich! »Meine kleine Liebesflöte« wurde gestrichen, und »Anton, steck den Degen ein« durfte so auch nicht gesungen werden. Alles, was delikat ist, war nicht mehr enthalten.
Letzte Frage: Wie wurde Ingeborg geboren?
Barrie Kosky: Am Beginn einer Arbeit mit Dagmar Manzel suchen wir zusammen nach starken Ideen. Wir wollten für Cleopatra keinen Femme-fatale-Stil à la Elisabeth Taylor. Nötig war ein abstoßendes, skandalöses Element. Für die Inszenierung ist sehr wichtig, dass Cleopatra in jeglicher Hinsicht »völlig Banane« ist. Ursprünglich hatte ich die Idee, Tänzer als Katzen auftreten zu lassen. Cleopatra umgeben von einer ganzen Schar von Katzen. Dann fiel uns aber auf, dass das sehr nach König der Löwen oder gar nach Cats aussehen könnte. Letztlich kam die Idee von Dagmar: Was wäre, wenn die Katze eine Art Puppe ist? Wir lieben beide Slapstick und Klamauk im Stil von Shari Lewis’ Lamb Chop. Unsere Cleopatra ist eine wirklich schlechte Bauchrednerin mit einer satirischen Katze. Wir gingen dreißig Namen durch und kamen schließlich auf Ingeborg. Ursprünglich sollte es so sein, dass Ingeborg Cleopatra spielen möchte, dann zogen wir in Erwägung, die Katze könne die Palast-Revolte des Kophra anstoßen. All diese Dinge waren montags witzig und am Dienstag nicht mehr. Ein solches Spielelement hilft, sich von der Zwangsvorstellung ästhetischer Perfektion zu befreien.
Ingeborg: Jenau! Und eens sach ick euch: Lange schau ick ma dit Rumjeeiere hier nich mehr an! Spätestens inner übanächsten Vorstellung übernehm ick Cleopatra ihre Partie! So sieht’s aus, wa!?
Barrie Kosky: Daher sind diese Stücke so außerordentlich interessant. Wir haben es mit einem Faden deutscher Kultur zu tun, der nie in seinem vollen Potential ausgesponnen wurde! Bedenken wir, dass der historische Raum, den wir hier abschreiten, gerade einmal 15 Jahre dauerte. Dann wurde dieser Faden abgeschnitten, und seine Energie verlagerte sich nach Amerika. Wenn die deutsche Kultur ein Körper wäre, dann wurden ihm buchstäblich die Beine herausgerissen. Und was in der Nachkriegszeit passierte, gerade auch mit Die Perlen der Cleopatra, ist ein Desaster.
Adam Benzwi: Ja, unglaublich! »Meine kleine Liebesflöte« wurde gestrichen, und »Anton, steck den Degen ein« durfte so auch nicht gesungen werden. Alles, was delikat ist, war nicht mehr enthalten.
Letzte Frage: Wie wurde Ingeborg geboren?
Barrie Kosky: Am Beginn einer Arbeit mit Dagmar Manzel suchen wir zusammen nach starken Ideen. Wir wollten für Cleopatra keinen Femme-fatale-Stil à la Elisabeth Taylor. Nötig war ein abstoßendes, skandalöses Element. Für die Inszenierung ist sehr wichtig, dass Cleopatra in jeglicher Hinsicht »völlig Banane« ist. Ursprünglich hatte ich die Idee, Tänzer als Katzen auftreten zu lassen. Cleopatra umgeben von einer ganzen Schar von Katzen. Dann fiel uns aber auf, dass das sehr nach König der Löwen oder gar nach Cats aussehen könnte. Letztlich kam die Idee von Dagmar: Was wäre, wenn die Katze eine Art Puppe ist? Wir lieben beide Slapstick und Klamauk im Stil von Shari Lewis’ Lamb Chop. Unsere Cleopatra ist eine wirklich schlechte Bauchrednerin mit einer satirischen Katze. Wir gingen dreißig Namen durch und kamen schließlich auf Ingeborg. Ursprünglich sollte es so sein, dass Ingeborg Cleopatra spielen möchte, dann zogen wir in Erwägung, die Katze könne die Palast-Revolte des Kophra anstoßen. All diese Dinge waren montags witzig und am Dienstag nicht mehr. Ein solches Spielelement hilft, sich von der Zwangsvorstellung ästhetischer Perfektion zu befreien.
Ingeborg: Jenau! Und eens sach ick euch: Lange schau ick ma dit Rumjeeiere hier nich mehr an! Spätestens inner übanächsten Vorstellung übernehm ick Cleopatra ihre Partie! So sieht’s aus, wa!?
Mehr dazu
23. Juni 2024
»Es kommen noch andere schöne Sachen!«
Die Perlen der Cleopatra war zu Beginn der Goldenen Zwanziger ein Riesenerfolg – vor allem, weil ihr Komponist Oscar Straus und seine Librettisten Julius Brammer und Alfred Grünwald mit der Operette ein sicheres Gespür für diese Zeit bewiesen. Bei ihrer deutschen und Berliner Erstaufführung 1924 herrschte in ganz Europa eine Ägyptomanie. In den Kaffeehäusern und Bars Berlins wurden Nil-Zigaretten geraucht, Modemacher, Juweliere und Friseure gestalteten Werke, die egal wie, aber doch ägyptisch aussahen. Die Büste der Nofretete war erstmals in Berlin zu sehen. Zwei Jahr zuvor wurde das Grab des Tutanchamun entdeckt. Allein darauf ist der Erfolg des Stücks über die ägyptische Pharaonin allerdings nicht zurückzuführen. Provokativ und subversiv witzig spottete sein Libretto über spießbürgerliche Moralvorstellungen und feierte eine neue Genussfreude am Ausleben urmenschlicher Triebe. Mitten hinein in dieses Stück frivoler Abendunterhaltung fand aber auch der Berliner Alltag seinen Widerhall, der geprägt war von Hyperinflation, Straßenkämpfen und Verelendung zahlreicher Milieus … Ein Einführung zur Geschichte der Operette von Simon Berger.
#KOBCleopatra
Einführung