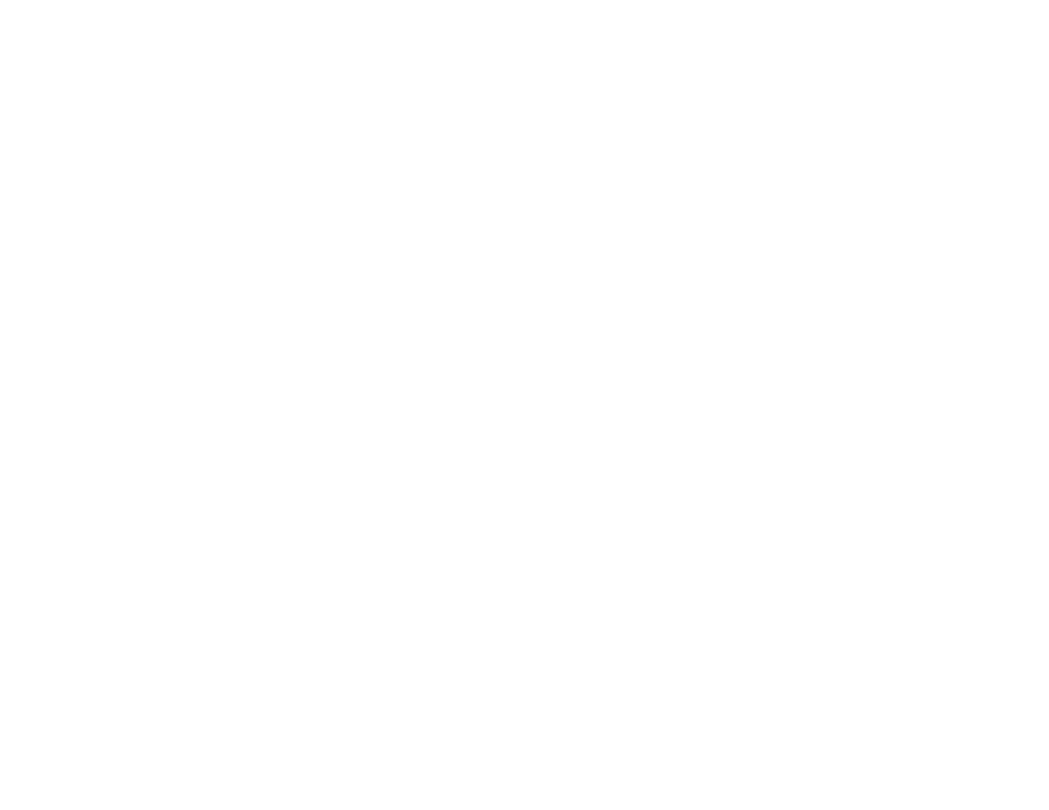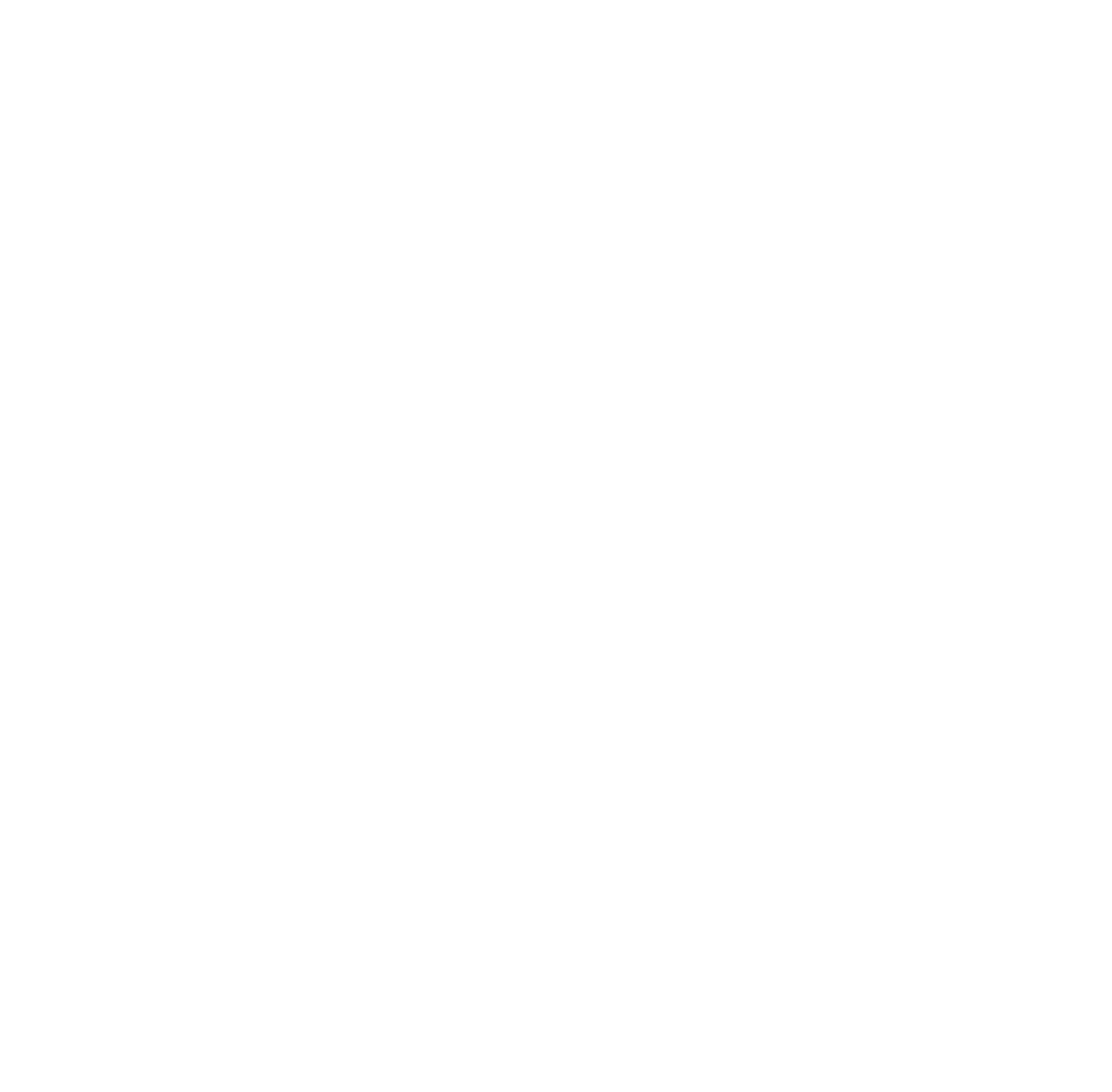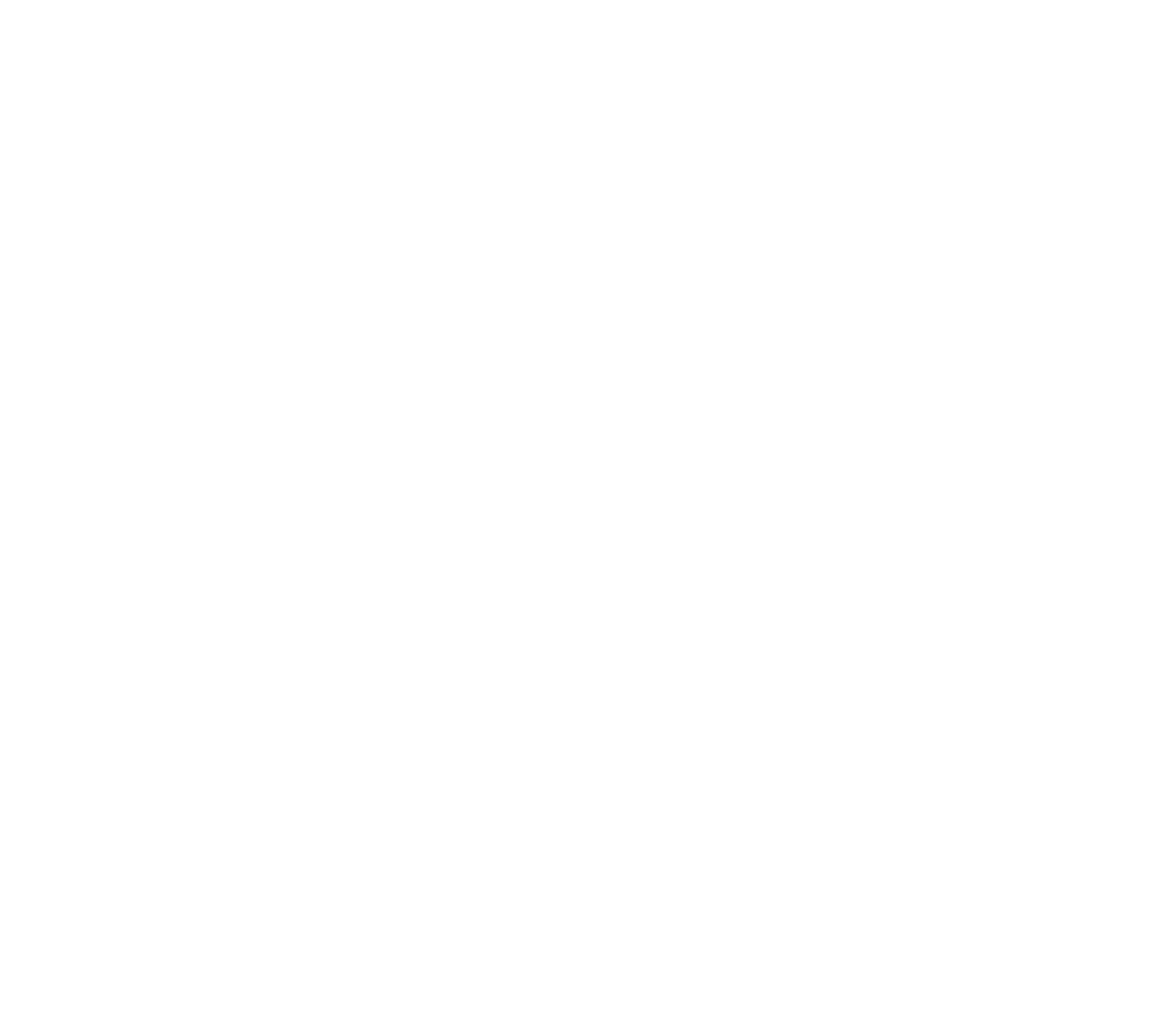© Monika Rittershaus
Das glorreiche Ökosystem der queeren Kultur
Interview mit Regisseur Barrie Kosky zu »La Cage aux Folles«
In den vergangenen Jahren wurde die Komische Oper Berlin in der Öffentlichkeit besonders durch die spektakulären Inszenierungen der sogenannten Berliner Jazz-Operetten wahrgenommen. Tatsächlich hast Du darüber hinaus nicht ganz unbemerkt ein weiteres Kapitel der Musiktheatergeschichte aufgeschlagen …
Barrie Kosky: Als ich vor 14 Jahren mit meinen Vorbereitungen als damals designierter Intendant begann, wusste ich: Es gibt eine Reihe großangelegter Musicals, die an dieses Haus gehören. Sie können hier in einer Weise präsentiert werden, wie es ein kommerzielles Theater niemals umsetzen könnte. Wenn man eines dieser Stücke am Broadway oder im West End, in einer der beiden Welt-Hauptstädte des kommerziellen Theaters New York oder London erlebt, dann in jedem Fall in einer Version mit reduziertem Orchester – heutzutage kann man froh sein, wenn am Broadway 13 Musiker:innen im Graben sitzen – und mit einem verkleinerten Cast. Für Musicals wie Kiss me, Kate, West Side Story und Anatevka waren aber ursprünglich ein großes Orchester und eine große Besetzung geplant. Ein Haus wie die Komische Oper Berlin kann mit seinem Orchesterapparat, seinem Ensemble und seinen Gästen diese Werke in einer Weise präsentieren, die sich kein Produzent am Broadway jemals leisten könnte! Wenn sich bei uns der Vorhang zu Beginn von La Cage aux Folles hebt, stehen fünfzig Drag-Queens auf der Bühne. Kein Theater der Welt außer einem deutschen Opernhaus könnte das schaffen.
Barrie Kosky: Als ich vor 14 Jahren mit meinen Vorbereitungen als damals designierter Intendant begann, wusste ich: Es gibt eine Reihe großangelegter Musicals, die an dieses Haus gehören. Sie können hier in einer Weise präsentiert werden, wie es ein kommerzielles Theater niemals umsetzen könnte. Wenn man eines dieser Stücke am Broadway oder im West End, in einer der beiden Welt-Hauptstädte des kommerziellen Theaters New York oder London erlebt, dann in jedem Fall in einer Version mit reduziertem Orchester – heutzutage kann man froh sein, wenn am Broadway 13 Musiker:innen im Graben sitzen – und mit einem verkleinerten Cast. Für Musicals wie Kiss me, Kate, West Side Story und Anatevka waren aber ursprünglich ein großes Orchester und eine große Besetzung geplant. Ein Haus wie die Komische Oper Berlin kann mit seinem Orchesterapparat, seinem Ensemble und seinen Gästen diese Werke in einer Weise präsentieren, die sich kein Produzent am Broadway jemals leisten könnte! Wenn sich bei uns der Vorhang zu Beginn von La Cage aux Folles hebt, stehen fünfzig Drag-Queens auf der Bühne. Kein Theater der Welt außer einem deutschen Opernhaus könnte das schaffen.
Das Genre Musical ist ein Kind des 20. Jahrhunderts. La Cage aux Folles ist Anfang der 1980er Jahre entstanden. Wie lässt sich La Cage aux Folles in der Geschichte des Musicals einordnen?
Barrie Kosky: Mit einem Bein steht es in der großen Tradition der Book-Musicals eines Richard Rodgers’ und Oscar Hammersteins II. Das Musical hat einen außergewöhnlichen Plot mit starken Charakteren – man lacht, man weint, man lacht, man weint, man wird auf eine große Reise mitgenommen, drei Stunden lang, mit Gesang und Tanz. Mit dem anderen Bein steht La Cage aux Folles in der Zukunft. Es ist das erste Musical mit zwei schwulen Männern in den Hauptrollen. Man kann Jerry Hermans Entscheidung, die er und sein Team in den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts in New York trafen, gar nicht überschätzen. Auf der einen Seite ist La Cage aux Folles also sehr nostalgisch, hat große Tanznummern und folgt allen Regeln eines Broadway-Musicals. Auf der anderen Seite ist es aufgrund des Themas am Broadway in den frühen 1980ern erstaunlich radikal.
Jerry Herman wird in Nachschlagewerken zum Musical bisweilen als konventionell und wenig originell abgeurteilt. Wie stehst Du zu dieser Kritik?
Barrie Kosky: Die Genialität von Jerry Herman liegt in der mühelosen Brillanz des Melodien-Schreibens. Es gibt Melodien, die bleiben einfach im Kopf hängen. Und nicht nur als »blöder Ohrwurm«, sondern wirklich schöne Melodien in der Tradition von Gershwin, Harold Arlen oder Jerome Kern. Schöne Balladen mit langen Melodiebögen ebenso wie wirklich mitreißende Nummern. Diese Leichtigkeit dieser Erfindungsgabe sollte nicht unterschätzt werden. Im Fall von La Cage aux Folles hatte Herman zudem das Glück, mit dem noch sehr jungen Autor Harvey Fierstein zusammenzuarbeiten.
Barrie Kosky: Mit einem Bein steht es in der großen Tradition der Book-Musicals eines Richard Rodgers’ und Oscar Hammersteins II. Das Musical hat einen außergewöhnlichen Plot mit starken Charakteren – man lacht, man weint, man lacht, man weint, man wird auf eine große Reise mitgenommen, drei Stunden lang, mit Gesang und Tanz. Mit dem anderen Bein steht La Cage aux Folles in der Zukunft. Es ist das erste Musical mit zwei schwulen Männern in den Hauptrollen. Man kann Jerry Hermans Entscheidung, die er und sein Team in den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts in New York trafen, gar nicht überschätzen. Auf der einen Seite ist La Cage aux Folles also sehr nostalgisch, hat große Tanznummern und folgt allen Regeln eines Broadway-Musicals. Auf der anderen Seite ist es aufgrund des Themas am Broadway in den frühen 1980ern erstaunlich radikal.
Jerry Herman wird in Nachschlagewerken zum Musical bisweilen als konventionell und wenig originell abgeurteilt. Wie stehst Du zu dieser Kritik?
Barrie Kosky: Die Genialität von Jerry Herman liegt in der mühelosen Brillanz des Melodien-Schreibens. Es gibt Melodien, die bleiben einfach im Kopf hängen. Und nicht nur als »blöder Ohrwurm«, sondern wirklich schöne Melodien in der Tradition von Gershwin, Harold Arlen oder Jerome Kern. Schöne Balladen mit langen Melodiebögen ebenso wie wirklich mitreißende Nummern. Diese Leichtigkeit dieser Erfindungsgabe sollte nicht unterschätzt werden. Im Fall von La Cage aux Folles hatte Herman zudem das Glück, mit dem noch sehr jungen Autor Harvey Fierstein zusammenzuarbeiten.

© Monika Rittershaus
Ein aufgehender Star am Broadway, der mit diesem Werk ganz am Anfang seiner Karriere einen ebenso witzigen wie zeitgemäßen Coup landete. Doch gab es schon weit vor La Cage aux Folles Musicals, die deutlich stärkeren Bezug auf die aktuellen musikalischen Entwicklungen insbesondere im Rock und Pop-Bereich genommen haben. Man denke nur an Jesus Christ Superstar oder ähnliche Werke...
Barrie Kosky: Jerry Herman greift melodisch und in der Art, wie er einen Chor oder eine Tanznummer schreibt, auf die Tradition der europäischen Operette zurück. Offenbach war auch ein genialer Melodiker, ebenso wie Johann Strauss, wie Lehár, wie Kálmán, wie Abraham und Spoliansky. Das Broadway-Musical hat das übernommen. Die Großeltern der meisten seiner Komponisten – George Gershwin, Stephen Sondheim, Irving Berlin, Jerry Herman – hörten europäische Opern und Operetten. Und diese wurden dann Teil der Neuerfindung der Operettentradition in New York. Ich bin immer etwas schockiert über den Snobismus vieler Deutscher gegenüber dem Musical, wenn es doch die natürliche Fortsetzung der deutschen und österreichischen Operette ist. Ist es nicht bewundernswert, wenn eine Kunstform von sich sagen kann: »Wir wollen, dass das so viele Leute wie möglich erleben. Wir wollen, dass es so unterhaltsam wie möglich ist. Aber wir werden euch zugleich eine sehr starke emotionale, menschliche Botschaft mitgeben.« Und dann wird es von Millionen und Abermillionen von Menschen auf der ganzen Welt gesehen. Das amerikanische Musical ist in meinen Augen ein sehr anspruchsvolles Genre. In der englischsprachigen Welt werden Musicals als völlig legitime Kunstform angesehen. In der europäischen Welt müssen die Opernhäuser immer noch darum kämpfen und den Leuten erklären, warum sie diese Stücke aufführen.
La Cage aux Folles hatte seine deutsche Erstaufführung am Theater des Westens 1985, das damals von Helmut Baumann geleitet wurde. Die frühen 1980er Jahre aber wurden in den USA und Europa dann durch den Ausbruch und die rasante Ausbreitung der Immunschwächekrankheit AIDS erschüttert …
Barrie Kosky: Ja, aber La Cage aux Folles lief weltweit mit großem Erfolg weiter, als die AIDS-Krise schon in vollem Gange war. Die weitere Entwicklung ist allerdings sehr interessant. Die Stückvorlage wurde – noch vor der AIDS-Krise – vor dem Hintergrund der kulturellen und sexuellen Revolution der 1960er und 70er Jahre geschrieben. Mitte der 1980er Jahre war es möglich, ein großes Broadway-Musical mit diesem Stoff auf die Beine zu stellen. Jerry Herman und Harvey Fierstein kamen auf die Idee: »Okay, wir können ein Musical schreiben, mit zwei schwulen Männern in den Hauptrollen, und zwar mit zwei schwulen Männern in einer Langzeitbeziehung. Zwei Männer, die sich lieben und einen Sohn großgezogen haben.« La Cage aux Folles ist letztendlich keine Drag-Show, es ist eine Show über Liebe, Beziehungen und Familie. Man feiert also die schwulen Beziehungen, die schwule Kultur und den Stolz darauf, der Anfang und Mitte der 80er aufkam. Und dann brach AIDS aus, vor allem in New York. Aus dem Feiern wurde ein Überleben. Und als so viele Menschen starben, wurde aus dem Überleben ein Gedenken. Es gibt ein Interview mit George Hearn, dem ersten Darsteller des Albin/Zaza. Darin spricht er davon, dass am Ende der New Yorker Saison die Hälfte der Besetzung an AIDS gestorben war. Es ist immer noch schockierend, das zu hören. »Ich bin, was ich bin« wandelte sich in den 1980er und 90er Jahren von einer Hymne des Feierns zu einer Hymne des Überlebens und schließlich zu einer Art Requiem. Anfang der 2000er Jahre geriet die Show ein wenig in Vergessenheit, galt in ihrer Vorstellung von schwuler Kultur als altmodisch und verstaubt. Das Gleiche passierte auch mit Anatevka und West Side Story. Verstaubt, knarzig, altmodisch und veraltet waren aber nicht die Stücke, sondern die Art und Weise, wie sie gemacht wurden. Es wird oft vergessen, was für ein radikales Stück Anatevka ist. Das Gleiche passierte mit La Cage aux Folles. Es wirkte mit einem Mal klischeehaft und die Leute wollten diese offenkundig queere Kultur nicht auf der Bühne sehen. Die Leute wollten diese unverschämte Figur Zaza nicht sehen. Für viele schwule Männer war er ein Stereotyp, einfach nur zum Weglaufen.
Barrie Kosky: Jerry Herman greift melodisch und in der Art, wie er einen Chor oder eine Tanznummer schreibt, auf die Tradition der europäischen Operette zurück. Offenbach war auch ein genialer Melodiker, ebenso wie Johann Strauss, wie Lehár, wie Kálmán, wie Abraham und Spoliansky. Das Broadway-Musical hat das übernommen. Die Großeltern der meisten seiner Komponisten – George Gershwin, Stephen Sondheim, Irving Berlin, Jerry Herman – hörten europäische Opern und Operetten. Und diese wurden dann Teil der Neuerfindung der Operettentradition in New York. Ich bin immer etwas schockiert über den Snobismus vieler Deutscher gegenüber dem Musical, wenn es doch die natürliche Fortsetzung der deutschen und österreichischen Operette ist. Ist es nicht bewundernswert, wenn eine Kunstform von sich sagen kann: »Wir wollen, dass das so viele Leute wie möglich erleben. Wir wollen, dass es so unterhaltsam wie möglich ist. Aber wir werden euch zugleich eine sehr starke emotionale, menschliche Botschaft mitgeben.« Und dann wird es von Millionen und Abermillionen von Menschen auf der ganzen Welt gesehen. Das amerikanische Musical ist in meinen Augen ein sehr anspruchsvolles Genre. In der englischsprachigen Welt werden Musicals als völlig legitime Kunstform angesehen. In der europäischen Welt müssen die Opernhäuser immer noch darum kämpfen und den Leuten erklären, warum sie diese Stücke aufführen.
La Cage aux Folles hatte seine deutsche Erstaufführung am Theater des Westens 1985, das damals von Helmut Baumann geleitet wurde. Die frühen 1980er Jahre aber wurden in den USA und Europa dann durch den Ausbruch und die rasante Ausbreitung der Immunschwächekrankheit AIDS erschüttert …
Barrie Kosky: Ja, aber La Cage aux Folles lief weltweit mit großem Erfolg weiter, als die AIDS-Krise schon in vollem Gange war. Die weitere Entwicklung ist allerdings sehr interessant. Die Stückvorlage wurde – noch vor der AIDS-Krise – vor dem Hintergrund der kulturellen und sexuellen Revolution der 1960er und 70er Jahre geschrieben. Mitte der 1980er Jahre war es möglich, ein großes Broadway-Musical mit diesem Stoff auf die Beine zu stellen. Jerry Herman und Harvey Fierstein kamen auf die Idee: »Okay, wir können ein Musical schreiben, mit zwei schwulen Männern in den Hauptrollen, und zwar mit zwei schwulen Männern in einer Langzeitbeziehung. Zwei Männer, die sich lieben und einen Sohn großgezogen haben.« La Cage aux Folles ist letztendlich keine Drag-Show, es ist eine Show über Liebe, Beziehungen und Familie. Man feiert also die schwulen Beziehungen, die schwule Kultur und den Stolz darauf, der Anfang und Mitte der 80er aufkam. Und dann brach AIDS aus, vor allem in New York. Aus dem Feiern wurde ein Überleben. Und als so viele Menschen starben, wurde aus dem Überleben ein Gedenken. Es gibt ein Interview mit George Hearn, dem ersten Darsteller des Albin/Zaza. Darin spricht er davon, dass am Ende der New Yorker Saison die Hälfte der Besetzung an AIDS gestorben war. Es ist immer noch schockierend, das zu hören. »Ich bin, was ich bin« wandelte sich in den 1980er und 90er Jahren von einer Hymne des Feierns zu einer Hymne des Überlebens und schließlich zu einer Art Requiem. Anfang der 2000er Jahre geriet die Show ein wenig in Vergessenheit, galt in ihrer Vorstellung von schwuler Kultur als altmodisch und verstaubt. Das Gleiche passierte auch mit Anatevka und West Side Story. Verstaubt, knarzig, altmodisch und veraltet waren aber nicht die Stücke, sondern die Art und Weise, wie sie gemacht wurden. Es wird oft vergessen, was für ein radikales Stück Anatevka ist. Das Gleiche passierte mit La Cage aux Folles. Es wirkte mit einem Mal klischeehaft und die Leute wollten diese offenkundig queere Kultur nicht auf der Bühne sehen. Die Leute wollten diese unverschämte Figur Zaza nicht sehen. Für viele schwule Männer war er ein Stereotyp, einfach nur zum Weglaufen.

© Monika Rittershaus
Dieser Stereotyp des exaltierten und extrovertierten bunten Vogels ist inzwischen weit über die Community hinaus bekannt. Aber seine Bewertung hat sich geändert, oder? Und der Schrecken von HIV ist aktuell angesichts der darauf folgenden und aktuellen Pandemie in den Hintergrund getreten ...
Barrie Kosky: Anfang der 2000er Jahre kamen Medikamente auf den Markt, sodass weniger Menschen an HIV/AIDS starben. Es ging nicht mehr ums schiere Überleben, sondern auch darum, weiterzuleben. Ich erinnere mich, dass in den 2000er Jahren, kurz bevor ich hierher kam, ein großer Teil der schwulen Kultur in Australien darin bestand, sich »heterosexuell« zu geben. Man musste zeigen, dass man nicht schwul war, dass man sich anpasste, dass es nicht mehr nur um die Rechte von Schwulen ging, dass es nicht mehr nur um die Homo-Ehe ging, dass es nicht mehr nur um die Gleichberechtigung ging, dass wir nicht immer als theatralisch und unverschämt und als »Zazas« gesehen werden wollten. Das halte ich für sehr problematisch, denn es gibt nicht den einen Typus der schwulen Gemeinschaft, so wie es auch nicht den einen Typus der jüdischen Gemeinschaft oder den einen Typus der Schwarzen Gemeinschaft oder den einen Typus der deutschen Gesellschaft gibt. Ich möchte sagen: Die queere Community besteht aus so vielen Untergruppen, sie besitzt eine solche Vielfalt und Diversität. Ich denke, was die Leute in den letzten zehn Jahren akzeptiert haben, ist die Idee, dass die queere Kultur sehr vielfältig ist und man innerhalb der Community jede mögliche Permutation von jeder vorstellbaren Persönlichkeit finden kann: Lederköniginnen, tätowierte Lesben, feminine Männer, Drag-Queens, trans* Performende, Muskelmänner, Leute, die sich wie Heterosexuelle kleiden und aussehen wollen.
Was für eine Auswirkung hatte diese Entwicklung auf ein Werk, das so klar in den 1970- und 80ern verhaftet ist?
Barrie Kosky: Das Stück wurde im Jahr 2010 neu erfunden. Harvey Fierstein schrieb einen großen Teil des Textes um und aktualisierte ihn, und plötzlich bekam das Stück ein ganz neues Leben. Parallel dazu wurde RuPaul’s Drag Race geboren, die international unglaublich erfolgreich war. Vor 20 Jahren konnte man sich kaum vorstellen, dass eine Show über Drag-Queens, die in Mode-, Talent- und Comedy-Shows gegeneinander antreten, ein internationales Phänomen sein könnte, das von Millionen von Menschen gesehen wird. Die Reise des Stücks folgt der schwulen Kultur über die letzten drei oder vier Jahrzehnte und jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, an dem Drag-Queens Superstars sind. Ich glaube, hier schließt sich der Kreis, und man darf sagen, dass in diesem glorreichen Ökosystem der schwulen Kultur alles möglich ist. Wie wunderbar!
Barrie Kosky: Anfang der 2000er Jahre kamen Medikamente auf den Markt, sodass weniger Menschen an HIV/AIDS starben. Es ging nicht mehr ums schiere Überleben, sondern auch darum, weiterzuleben. Ich erinnere mich, dass in den 2000er Jahren, kurz bevor ich hierher kam, ein großer Teil der schwulen Kultur in Australien darin bestand, sich »heterosexuell« zu geben. Man musste zeigen, dass man nicht schwul war, dass man sich anpasste, dass es nicht mehr nur um die Rechte von Schwulen ging, dass es nicht mehr nur um die Homo-Ehe ging, dass es nicht mehr nur um die Gleichberechtigung ging, dass wir nicht immer als theatralisch und unverschämt und als »Zazas« gesehen werden wollten. Das halte ich für sehr problematisch, denn es gibt nicht den einen Typus der schwulen Gemeinschaft, so wie es auch nicht den einen Typus der jüdischen Gemeinschaft oder den einen Typus der Schwarzen Gemeinschaft oder den einen Typus der deutschen Gesellschaft gibt. Ich möchte sagen: Die queere Community besteht aus so vielen Untergruppen, sie besitzt eine solche Vielfalt und Diversität. Ich denke, was die Leute in den letzten zehn Jahren akzeptiert haben, ist die Idee, dass die queere Kultur sehr vielfältig ist und man innerhalb der Community jede mögliche Permutation von jeder vorstellbaren Persönlichkeit finden kann: Lederköniginnen, tätowierte Lesben, feminine Männer, Drag-Queens, trans* Performende, Muskelmänner, Leute, die sich wie Heterosexuelle kleiden und aussehen wollen.
Was für eine Auswirkung hatte diese Entwicklung auf ein Werk, das so klar in den 1970- und 80ern verhaftet ist?
Barrie Kosky: Das Stück wurde im Jahr 2010 neu erfunden. Harvey Fierstein schrieb einen großen Teil des Textes um und aktualisierte ihn, und plötzlich bekam das Stück ein ganz neues Leben. Parallel dazu wurde RuPaul’s Drag Race geboren, die international unglaublich erfolgreich war. Vor 20 Jahren konnte man sich kaum vorstellen, dass eine Show über Drag-Queens, die in Mode-, Talent- und Comedy-Shows gegeneinander antreten, ein internationales Phänomen sein könnte, das von Millionen von Menschen gesehen wird. Die Reise des Stücks folgt der schwulen Kultur über die letzten drei oder vier Jahrzehnte und jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, an dem Drag-Queens Superstars sind. Ich glaube, hier schließt sich der Kreis, und man darf sagen, dass in diesem glorreichen Ökosystem der schwulen Kultur alles möglich ist. Wie wunderbar!
Heute schreiben wir das Jahr 2023. Seit 2010 sind schon wieder über zehn Jahre vergangen und der Gender-Diskurs hat weiter an Fahrt aufgenommen. Muss man weitere Anpassungen vornehmen, um das Werk aktuell zu halten?
Barrie Kosky: Wir haben nichts am Text umgeschrieben! Und wenn man ihn heute hört, fragt man sich: »Oh mein Gott, wisst ihr, worüber die da sprechen?!« Darüber, ob zwei Männer in einer Beziehung sein können, ob sie wie Eltern handeln und behandelt werden können, ob sie ihr Kind erziehen können, was die Definition von Familie ist. Das ist nicht »staubig« oder irrelevant, und es tut das, was alle großen amerikanischen Musicals tun: Sie befassen sich mit sehr tiefgründigen Dingen. Das Geniale ist, dass sie dies im Kontext der »Unterhaltung« tun. Anatevka ist drei Stunden Unterhaltung, aber es behandelt Themen wie Antisemitismus, Exil und Familie. West Side Story ist drei Stunden Unterhaltung in einem Broadway-Musical, das sich mit Anmut und jungen Menschen, Armut und Gewalt beschäftigt. Das Gleiche gilt für La Cage aux Folles. Es bietet große Unterhaltung, ist aber vor allem ein Stück, das der Definition von Familie auf den Grund gehen möchte. So wird das Stück atemberaubend aktuell und zugleich unterhaltsam.
In der aktuellen Inszenierung sind die beiden Protagonist:innen eher etwas älter besetzt als man es oft sieht …
Barrie Kosky: Das war mir von Anfang an absolut klar. Ich habe bis heute an die zwanzig Produktionen gesehen, unter anderem als Teenager die Originalproduktion am Broadway in New York. Darin waren Albin und Georges beide mittleren Alters, so um die 50, und ich dachte, das sei wichtig. Ich habe die Show über die Jahre mit ziemlich jungen Albins und ziemlich jungen Georges gesehen, und für mich ergibt das keinen Sinn. Diese beiden Männer müssen eine Vergangenheit haben. Man muss das Gefühl haben, dass sie schon einige Jahrzehnte zusammen sind, dass sie nicht mehr jung waren, als sie sich kennenlernten, denn Georges hatte eine Beziehung mit einer Frau und hat einen Sohn. Wir alle lieben es, tollen jungen Leuten beim Tanzen und Singen zuzusehen. Aber es gibt etwas, das man mitbringt, wenn man seit 40 Jahren auf der Bühne steht wie Peter Renz oder Stefan Kurt – eine innere Tiefe, die ich nicht zu inszenieren brauche. Ich liebe es, Leute mit Lebenserfahrung auf der Bühne zu sehen.
Albin und Zaza sind nicht nur gesanglich, sondern auch darstellerisch ebenso unterschiedliche wie herausfordernde Partien …
Barrie Kosky: Stefan Kurt hat die Rolle des Albin/Zaza vor ein paar Jahren am Theater Basel mit großem Erfolg gespielt. Genau wie bei Anatevka mit Max Hopp war ich mir sicher: Diese Rolle muss von einem Schauspieler übernommen werden. Die beste Zaza, die ich je gesehen habe, war Harvey Fierstein, der die Rolle 2011 zum allerersten Mal am Broadway spielte. Er hat zwar das Buch geschrieben, kann aber eigentlich nicht singen. Man kann auf YouTube sehen, wie er bei »I am what I am« eigentlich nur fünf Noten singt. Der Rest ist eine Lehrstunde in Schauspiel und darin, dass es nicht darum geht, eine perfekte Stimme zu haben. Es ist für mich die beste Version von »I am what I am«, die es je gab, denn Fierstein behandelt den Song wie einen Monolog. Als Gegenpart war es mir sehr wichtig, dass Peter Renz, den eine lange, großartige Geschichte mit diesem Haus verbindet, Georges spielt. Diese beiden Figuren sind sehr unterschiedlich. Zaza/Albin ist ein sehr unverschämter, extravaganter Charakter, und diese Art von schwulen Männern bewundere ich. Aber viele schwule Männer mögen es nicht, wenn sie einen weiblichen Mann oder diese Extravaganz sehen. Ich glaube aber, dass viele Menschen auf der ganzen Welt genau solche extravaganten Persönlichkeiten sind. Und dann gibt es noch Georges. Ihm gehört der Club, er ist der Betreiber des Clubs, er kann »das Spiel« spielen. Und er hatte vorher eine Beziehung mit einer Frau. Sie sind sicherlich legitime Vertreter von zwei Typen von Männern. Um noch einmal den Vergleich zu Anatevka zu ziehen: Tevje und seine Familie repräsentieren nicht alle Juden, aber der Mikrokosmos dieser Familie repräsentiert etwas, mit dem wir uns identifizieren können. Dasselbe trifft auf La Cage aux Folles zu.
Barrie Kosky: Wir haben nichts am Text umgeschrieben! Und wenn man ihn heute hört, fragt man sich: »Oh mein Gott, wisst ihr, worüber die da sprechen?!« Darüber, ob zwei Männer in einer Beziehung sein können, ob sie wie Eltern handeln und behandelt werden können, ob sie ihr Kind erziehen können, was die Definition von Familie ist. Das ist nicht »staubig« oder irrelevant, und es tut das, was alle großen amerikanischen Musicals tun: Sie befassen sich mit sehr tiefgründigen Dingen. Das Geniale ist, dass sie dies im Kontext der »Unterhaltung« tun. Anatevka ist drei Stunden Unterhaltung, aber es behandelt Themen wie Antisemitismus, Exil und Familie. West Side Story ist drei Stunden Unterhaltung in einem Broadway-Musical, das sich mit Anmut und jungen Menschen, Armut und Gewalt beschäftigt. Das Gleiche gilt für La Cage aux Folles. Es bietet große Unterhaltung, ist aber vor allem ein Stück, das der Definition von Familie auf den Grund gehen möchte. So wird das Stück atemberaubend aktuell und zugleich unterhaltsam.
In der aktuellen Inszenierung sind die beiden Protagonist:innen eher etwas älter besetzt als man es oft sieht …
Barrie Kosky: Das war mir von Anfang an absolut klar. Ich habe bis heute an die zwanzig Produktionen gesehen, unter anderem als Teenager die Originalproduktion am Broadway in New York. Darin waren Albin und Georges beide mittleren Alters, so um die 50, und ich dachte, das sei wichtig. Ich habe die Show über die Jahre mit ziemlich jungen Albins und ziemlich jungen Georges gesehen, und für mich ergibt das keinen Sinn. Diese beiden Männer müssen eine Vergangenheit haben. Man muss das Gefühl haben, dass sie schon einige Jahrzehnte zusammen sind, dass sie nicht mehr jung waren, als sie sich kennenlernten, denn Georges hatte eine Beziehung mit einer Frau und hat einen Sohn. Wir alle lieben es, tollen jungen Leuten beim Tanzen und Singen zuzusehen. Aber es gibt etwas, das man mitbringt, wenn man seit 40 Jahren auf der Bühne steht wie Peter Renz oder Stefan Kurt – eine innere Tiefe, die ich nicht zu inszenieren brauche. Ich liebe es, Leute mit Lebenserfahrung auf der Bühne zu sehen.
Albin und Zaza sind nicht nur gesanglich, sondern auch darstellerisch ebenso unterschiedliche wie herausfordernde Partien …
Barrie Kosky: Stefan Kurt hat die Rolle des Albin/Zaza vor ein paar Jahren am Theater Basel mit großem Erfolg gespielt. Genau wie bei Anatevka mit Max Hopp war ich mir sicher: Diese Rolle muss von einem Schauspieler übernommen werden. Die beste Zaza, die ich je gesehen habe, war Harvey Fierstein, der die Rolle 2011 zum allerersten Mal am Broadway spielte. Er hat zwar das Buch geschrieben, kann aber eigentlich nicht singen. Man kann auf YouTube sehen, wie er bei »I am what I am« eigentlich nur fünf Noten singt. Der Rest ist eine Lehrstunde in Schauspiel und darin, dass es nicht darum geht, eine perfekte Stimme zu haben. Es ist für mich die beste Version von »I am what I am«, die es je gab, denn Fierstein behandelt den Song wie einen Monolog. Als Gegenpart war es mir sehr wichtig, dass Peter Renz, den eine lange, großartige Geschichte mit diesem Haus verbindet, Georges spielt. Diese beiden Figuren sind sehr unterschiedlich. Zaza/Albin ist ein sehr unverschämter, extravaganter Charakter, und diese Art von schwulen Männern bewundere ich. Aber viele schwule Männer mögen es nicht, wenn sie einen weiblichen Mann oder diese Extravaganz sehen. Ich glaube aber, dass viele Menschen auf der ganzen Welt genau solche extravaganten Persönlichkeiten sind. Und dann gibt es noch Georges. Ihm gehört der Club, er ist der Betreiber des Clubs, er kann »das Spiel« spielen. Und er hatte vorher eine Beziehung mit einer Frau. Sie sind sicherlich legitime Vertreter von zwei Typen von Männern. Um noch einmal den Vergleich zu Anatevka zu ziehen: Tevje und seine Familie repräsentieren nicht alle Juden, aber der Mikrokosmos dieser Familie repräsentiert etwas, mit dem wir uns identifizieren können. Dasselbe trifft auf La Cage aux Folles zu.

© Monika Rittershaus
Die Welt, in der sich die beiden finden, ist die des Drags. Drag spielt in diesem Musical eine weit größere Rolle als nur ansprechende Dekoration …
Barrie Kosky: Ich benutze Drag in meinem Theater seit 35 Jahren, seit meinen Theater-Anfängen an der Universität. Das gleiche gilt für die Tradition des Vaudeville. Was ich immer sehr interessant finde ist, wie sich in vielen Kritiken eine gewisse Homophobie zeigt, sobald man das auf der Bühne macht – auch in Deutschland. Es gab eine Menge deutscher Opernfeuilletons, die über meine Inszenierungen Worte wie »tuntig« oder »noch einmal – Barrie Kosky steckt alle in ein Kleid« verloren haben. Dabei ist das eigentlich nur ein ganz kleiner Bestandteil meiner Inszenierungen. Diese Vorstellung aber, dass es etwas Schreckliches, etwas Negatives, etwas Oberflächliches an sich hat, ist meiner Meinung nach eher ein Spiegelbild der Person, die das schreibt. Für mich aber ist dies nicht nur seit 35 Jahren Teil meiner Theaterarbeit, sondern ein wichtiger Teil der Theatergeschichte im Allgemeinen.
Viele Menschen genießen heute eine Sendung wie RuPaul’s Drag Race. Gleichzeitig nimmt die Diskussion über Gender-Identität und die adäquate Repräsentation auch anderer gesellschaftlicher Minderheiten an Fahrt auf und wird zusehends hitziger …
Barrie Kosky: Ich denke, die Diskussionen, die in den letzten 10 oder 15 Jahren losgetreten wurden, sei es »Black Lives Matter«, sei es »MeToo«, sei es die LGBTQIA+ Community, die bestimmte Themen wie die Feindlichkeit gegen trans* Menschen und die Homo-Ehe anspricht, sehr wichtig ist – ebenso wie die Diskussion all jener Themen, die unter dem Konstrukt einer weißen, patriarchalischen, bürgerlichen, westlichen Kultur zu Tage getreten sind. Es ist sehr wichtig, dass Menschen eine Stimme bekommen. Auf der anderen Seite besteht auch die Gefahr, dass Dogmen und Mantren das ersetzen, was eine Feier der Vielfalt und des Dialogs sein sollte. Neulich habe ich einen guten Satz gehört: »Dialog bedeutet nicht automatisch Missbrauch«. Ich meine damit den Dialog als wertschätzenden, aber durchaus auch kontroversen Austausch unterschiedlicher Meinungen. Ich sehe sehr wohl, dass wir in einer gefährlichen Welt leben, in der all die guten Dinge dieser Diskussionen durch ein Dogma ausgelöscht werden könnten. Aber was ist schwule Kultur, wenn nicht eine Feier der Vielfalt! Wäre es nicht wunderbar, in einer Welt zu leben, in der Sexualität nicht wirklich diskutiert wird, weil sie einfach vorausgesetzt wird? Aber so weit sind wir noch nicht.
Gibt es einen Rat, den Du den nächsten Generationen von queeren Menschen mit auf den Weg geben würdest?
Barrie Kosky: Für die jüngeren Generationen ist es wichtig zu wissen, dass viele Menschen für ihre Freiheit gestorben sind. Nicht nur in der AIDS-Krise, sondern auch davor: durch Gewalt, im Gefängnis, durch Missbrauch. Diese sehr mutigen Menschen haben im 20. Jahrhundert und besonders in den 1960er, 70er und 80er Jahren wirklich für die Rechte der Homosexuellen gekämpft. Das muss respektiert werden. Man kann das nicht einfach mit einem »Das war eine andere Zeit.« wegwischen. Das ist beleidigend. Die schwule Geschichte ist wie die jüdische Geschichte oder die deutsche Geschichte oder die Musikgeschichte. Sie hat eine erstaunliche Tradition, und diese Vergangenheit informiert uns heute. Wir fangen nicht bei null an.
Die Vergangenheit nicht vergessen, um in der Gegenwart angemessen zu handeln. Es gibt viel zu tun und das in einer Zeit, in der die Welt an allen Ecken brennt. Viele Menschen sind dieser Tage überdurchschnittlich gefordert und deshalb sehr angespannt und sorgenvoll …
Barrie Kosky: Die Aufführung von La Cage aux Folles sollte für die Leute wie eine Batterie sein! Nach dem Besuch sollten sich alle viel, viel besser fühlen als davor. Die Vorstellung sollte sie befreien! Befreien, unterhalten und vielleicht etwas Farbe in ihr Leben bringen. Es ist so wichtig, das Musiktheater als einen Ort zu haben, wo man für drei Stunden den Alltag vergessen kann, um neue Energie zu tanken. Das ist so lebenswichtig wie ein Schluck Wasser.
Barrie Kosky: Ich benutze Drag in meinem Theater seit 35 Jahren, seit meinen Theater-Anfängen an der Universität. Das gleiche gilt für die Tradition des Vaudeville. Was ich immer sehr interessant finde ist, wie sich in vielen Kritiken eine gewisse Homophobie zeigt, sobald man das auf der Bühne macht – auch in Deutschland. Es gab eine Menge deutscher Opernfeuilletons, die über meine Inszenierungen Worte wie »tuntig« oder »noch einmal – Barrie Kosky steckt alle in ein Kleid« verloren haben. Dabei ist das eigentlich nur ein ganz kleiner Bestandteil meiner Inszenierungen. Diese Vorstellung aber, dass es etwas Schreckliches, etwas Negatives, etwas Oberflächliches an sich hat, ist meiner Meinung nach eher ein Spiegelbild der Person, die das schreibt. Für mich aber ist dies nicht nur seit 35 Jahren Teil meiner Theaterarbeit, sondern ein wichtiger Teil der Theatergeschichte im Allgemeinen.
Viele Menschen genießen heute eine Sendung wie RuPaul’s Drag Race. Gleichzeitig nimmt die Diskussion über Gender-Identität und die adäquate Repräsentation auch anderer gesellschaftlicher Minderheiten an Fahrt auf und wird zusehends hitziger …
Barrie Kosky: Ich denke, die Diskussionen, die in den letzten 10 oder 15 Jahren losgetreten wurden, sei es »Black Lives Matter«, sei es »MeToo«, sei es die LGBTQIA+ Community, die bestimmte Themen wie die Feindlichkeit gegen trans* Menschen und die Homo-Ehe anspricht, sehr wichtig ist – ebenso wie die Diskussion all jener Themen, die unter dem Konstrukt einer weißen, patriarchalischen, bürgerlichen, westlichen Kultur zu Tage getreten sind. Es ist sehr wichtig, dass Menschen eine Stimme bekommen. Auf der anderen Seite besteht auch die Gefahr, dass Dogmen und Mantren das ersetzen, was eine Feier der Vielfalt und des Dialogs sein sollte. Neulich habe ich einen guten Satz gehört: »Dialog bedeutet nicht automatisch Missbrauch«. Ich meine damit den Dialog als wertschätzenden, aber durchaus auch kontroversen Austausch unterschiedlicher Meinungen. Ich sehe sehr wohl, dass wir in einer gefährlichen Welt leben, in der all die guten Dinge dieser Diskussionen durch ein Dogma ausgelöscht werden könnten. Aber was ist schwule Kultur, wenn nicht eine Feier der Vielfalt! Wäre es nicht wunderbar, in einer Welt zu leben, in der Sexualität nicht wirklich diskutiert wird, weil sie einfach vorausgesetzt wird? Aber so weit sind wir noch nicht.
Gibt es einen Rat, den Du den nächsten Generationen von queeren Menschen mit auf den Weg geben würdest?
Barrie Kosky: Für die jüngeren Generationen ist es wichtig zu wissen, dass viele Menschen für ihre Freiheit gestorben sind. Nicht nur in der AIDS-Krise, sondern auch davor: durch Gewalt, im Gefängnis, durch Missbrauch. Diese sehr mutigen Menschen haben im 20. Jahrhundert und besonders in den 1960er, 70er und 80er Jahren wirklich für die Rechte der Homosexuellen gekämpft. Das muss respektiert werden. Man kann das nicht einfach mit einem »Das war eine andere Zeit.« wegwischen. Das ist beleidigend. Die schwule Geschichte ist wie die jüdische Geschichte oder die deutsche Geschichte oder die Musikgeschichte. Sie hat eine erstaunliche Tradition, und diese Vergangenheit informiert uns heute. Wir fangen nicht bei null an.
Die Vergangenheit nicht vergessen, um in der Gegenwart angemessen zu handeln. Es gibt viel zu tun und das in einer Zeit, in der die Welt an allen Ecken brennt. Viele Menschen sind dieser Tage überdurchschnittlich gefordert und deshalb sehr angespannt und sorgenvoll …
Barrie Kosky: Die Aufführung von La Cage aux Folles sollte für die Leute wie eine Batterie sein! Nach dem Besuch sollten sich alle viel, viel besser fühlen als davor. Die Vorstellung sollte sie befreien! Befreien, unterhalten und vielleicht etwas Farbe in ihr Leben bringen. Es ist so wichtig, das Musiktheater als einen Ort zu haben, wo man für drei Stunden den Alltag vergessen kann, um neue Energie zu tanken. Das ist so lebenswichtig wie ein Schluck Wasser.
Mehr dazu
12. März 2025
Menschliche Kaleidoskope
In Barrie Koskys Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny gibt es kein Entkommen: Jeder sieht sich selbst – vervielfacht, verzerrt, gefangen im eigenen Spiegelbild. Zwischen Gier, Macht und Untergang entfaltet sich eine Welt, in der alles erlaubt und der Absturz garantiert ist. In Mahagonny vereinen sich Brechts so schneidender Blick auf die Gesellschaft und Weills grandios-mitreissende Musik zu einem schmerzhaften und aktuellen Blick auf Narzissmus – und auf eine Gesellschaft, die ihren Gemeinsinn verliert. In ganz realen Spiegeln auf der sonst kargen Bühne entfaltet Barrie Kosky die Oper zu einem Kaleidoskop menschlicher Absurdität und fragt: Was bleibt von uns, wenn wir uns selbst nicht mehr erkennen? Ein Gespräch über die Bibel, Selfies und den Sündenbock in seiner Inszenierung.
#KOBMahagonny
Interview
20. März 2024
Wo ein Wille ist
Regisseur Barrie Kosky und Dirigent Adam Benzwi im Gespräch über Schutzengel, Wiener Wohnzimmer, eiskalten Martini und ihre Inzenenierung Eine Frau, die weiss, was sie will!
#KOBEineFrau
Interview
6. März 2024
Spielwut von Knast bis Klapse
Dagmar Manzel und Max Hopp über Tempo, Sandkästen und die Schauspielerei in Eine Frau, die weiß, was sie will.
#KOBEineFrau