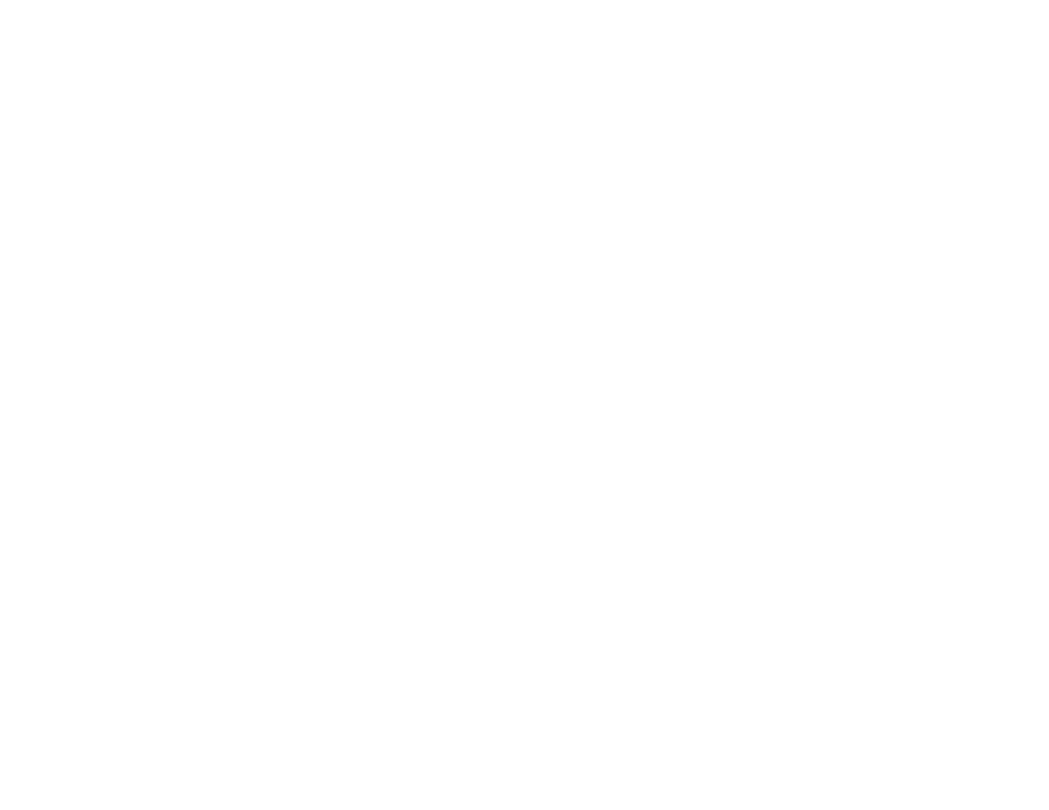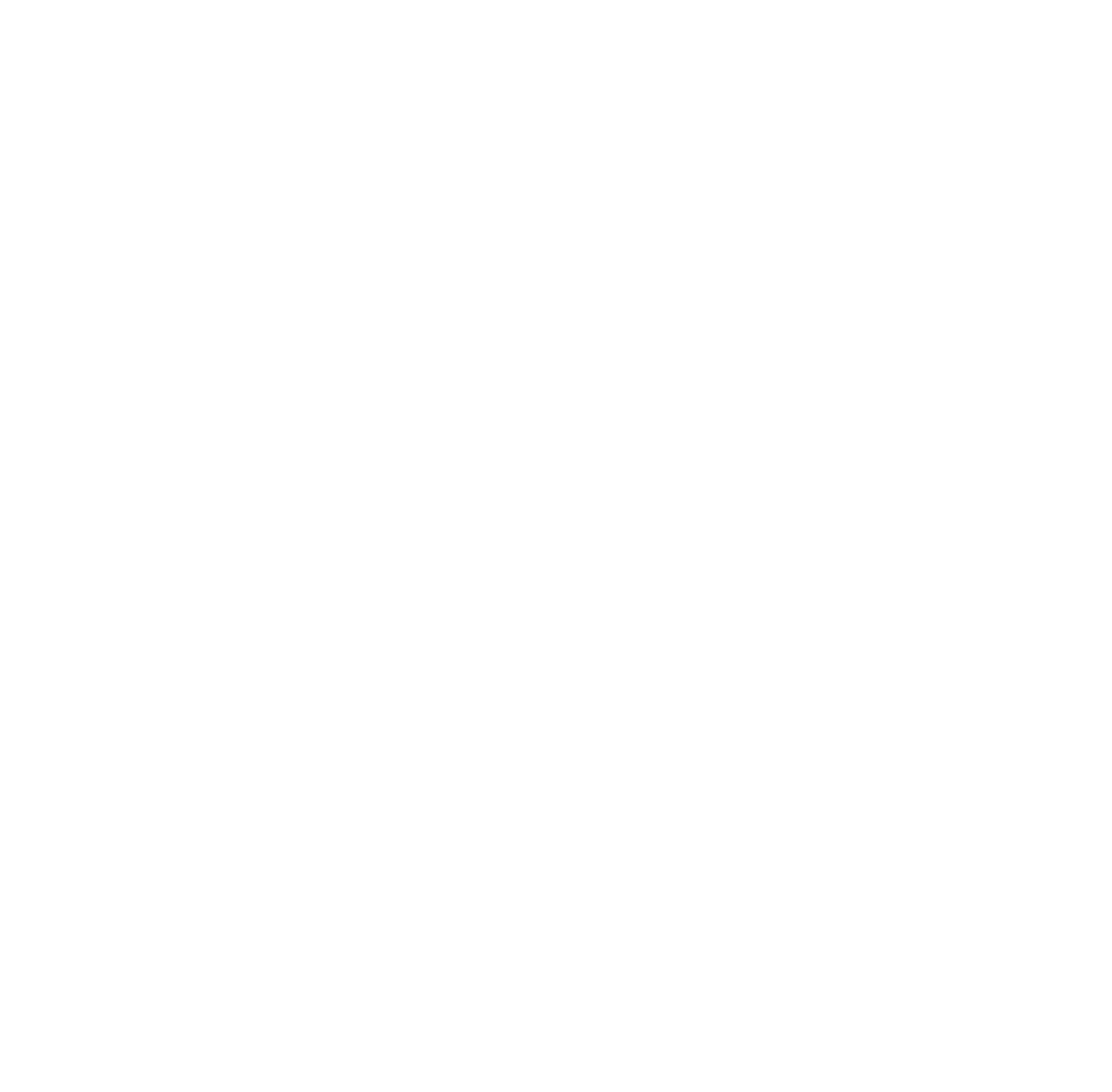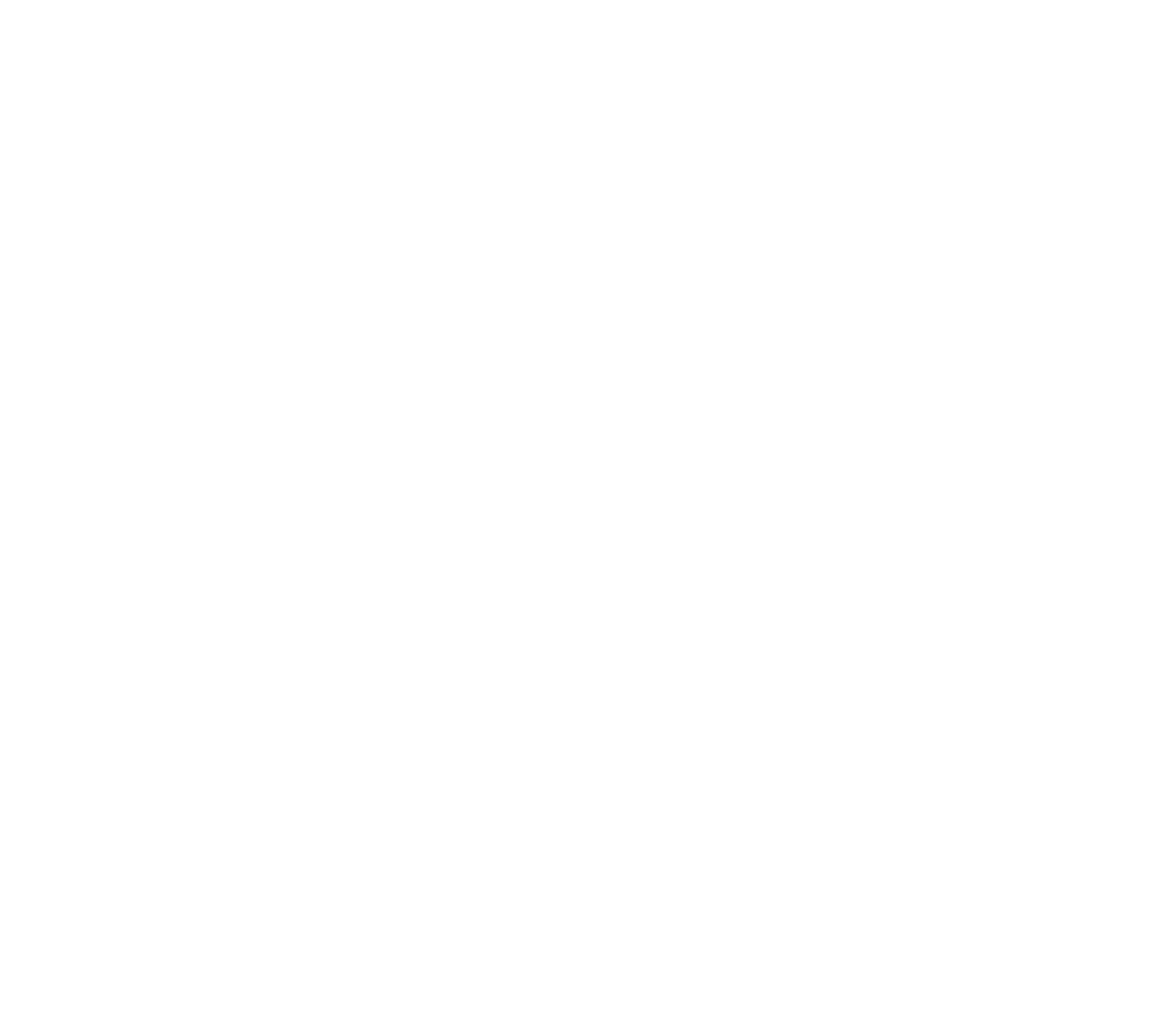© Iko Freese / drama-berlin.de
Quicklebendig zwischen Freude und Zusammenbruch
Dirigent Koen Schoots im Gespräch über den richtigen Sound, den Klassiker Anatevka und Mozart als Musicalkomponisten
Sie dirigieren erstmals Anatevka – stellt die Gattung Musical besondere Anforderungen an den Dirigenten?
Koen Schoots Jedes Stück in einer neuen Produktion ist aufregend. Nun hat Anatevka eine herausragende Bedeutung für die Komische Oper Berlin, zumal in der Jubiläumsspielzeit, und die Zusammenarbeit findet mit Barrie Kosky statt – das verleiht dieser Arbeit etwas sehr Besonderes. Grundsätzlich ist Musiktheater aber Musiktheater; und ob Oper, Musical oder Operette: Man muss immer genau und mit dem entsprechenden Handwerkszeug an den Stücken arbeiten. Beim Musical gibt es bisweilen andere musikalische Gesetze– die Stilistik, die Klangvorstellungen unterscheiden sich durchaus von anderen Genres. Auch die stimmlichen Anforderungen können andere sein als bei einer Oper. Aber im Großen und Ganzen gibt es in Anatevka sehr viele klassische Elemente. Hinzu kommt natürlich das jiddische und russische Kolorit, das Stück ist eigentlich ein Zwitter.
Was bedeutet das?
Koen Schoots Man kann Anatevka nur bedingt mit einem wirklich modernen Musical vergleichen. Das Stück ist mittlerweile 53 Jahre alt, also eigentlich schon ein Klassiker. Anfang der 70er-Jahre gab es einen Bruch in der Entwicklung des Musicals, hin zu Rockmusicals wie Hair (1968) und Jesus Christ Superstar (1971). In den 80er-Jahren kamen dann Megaproduktionen heraus, Riesenschinken wie Les Misérables (1980) und Phantom der Oper (1986). Bei diesen Stücken ist bis heute genau vorgeschrieben, wie sie zu machen sind, einschließlich der visuellen Gestaltung. Dagegen ist Anatevka aus einer viel älteren Tradition heraus entstanden. In den 30er-Jahren wurden die meisten Musicals – auch die amerikanischen – eher mit singenden Schauspielern besetzt, weniger mit Sängern. Die Werke der 60er-Jahre nehmen eine Mittelposition ein; Tevje beispielsweise wird oft mit einem Bassbuffo oder einem Baritonbuffo besetzt. Das halte ich für falsch, weil man dann immer gewisse Klischees bedient.
… ihn also mit einem Opernsänger besetzt, der sonst auch den Leporello gibt?
Koen Schoots Genau. Der singt dann diese Nummern in Anatevka, als würde er gerade den Wildschütz von Lortzing singen. Stilistisch ist das nicht korrekt. Mit Max Hopp haben wir einen Tevje, der nicht automatisch in diese Sängergestik verfällt. Jerry Bock schrieb für Schauspielerstimmen. Das ist eine ganz andere Art des Umgangs mit der Stimme als bei zeitgenössischen Musicals – eher vergleichbar mit Stücken wie Carousel (1945).
Koen Schoots Jedes Stück in einer neuen Produktion ist aufregend. Nun hat Anatevka eine herausragende Bedeutung für die Komische Oper Berlin, zumal in der Jubiläumsspielzeit, und die Zusammenarbeit findet mit Barrie Kosky statt – das verleiht dieser Arbeit etwas sehr Besonderes. Grundsätzlich ist Musiktheater aber Musiktheater; und ob Oper, Musical oder Operette: Man muss immer genau und mit dem entsprechenden Handwerkszeug an den Stücken arbeiten. Beim Musical gibt es bisweilen andere musikalische Gesetze– die Stilistik, die Klangvorstellungen unterscheiden sich durchaus von anderen Genres. Auch die stimmlichen Anforderungen können andere sein als bei einer Oper. Aber im Großen und Ganzen gibt es in Anatevka sehr viele klassische Elemente. Hinzu kommt natürlich das jiddische und russische Kolorit, das Stück ist eigentlich ein Zwitter.
Was bedeutet das?
Koen Schoots Man kann Anatevka nur bedingt mit einem wirklich modernen Musical vergleichen. Das Stück ist mittlerweile 53 Jahre alt, also eigentlich schon ein Klassiker. Anfang der 70er-Jahre gab es einen Bruch in der Entwicklung des Musicals, hin zu Rockmusicals wie Hair (1968) und Jesus Christ Superstar (1971). In den 80er-Jahren kamen dann Megaproduktionen heraus, Riesenschinken wie Les Misérables (1980) und Phantom der Oper (1986). Bei diesen Stücken ist bis heute genau vorgeschrieben, wie sie zu machen sind, einschließlich der visuellen Gestaltung. Dagegen ist Anatevka aus einer viel älteren Tradition heraus entstanden. In den 30er-Jahren wurden die meisten Musicals – auch die amerikanischen – eher mit singenden Schauspielern besetzt, weniger mit Sängern. Die Werke der 60er-Jahre nehmen eine Mittelposition ein; Tevje beispielsweise wird oft mit einem Bassbuffo oder einem Baritonbuffo besetzt. Das halte ich für falsch, weil man dann immer gewisse Klischees bedient.
… ihn also mit einem Opernsänger besetzt, der sonst auch den Leporello gibt?
Koen Schoots Genau. Der singt dann diese Nummern in Anatevka, als würde er gerade den Wildschütz von Lortzing singen. Stilistisch ist das nicht korrekt. Mit Max Hopp haben wir einen Tevje, der nicht automatisch in diese Sängergestik verfällt. Jerry Bock schrieb für Schauspielerstimmen. Das ist eine ganz andere Art des Umgangs mit der Stimme als bei zeitgenössischen Musicals – eher vergleichbar mit Stücken wie Carousel (1945).
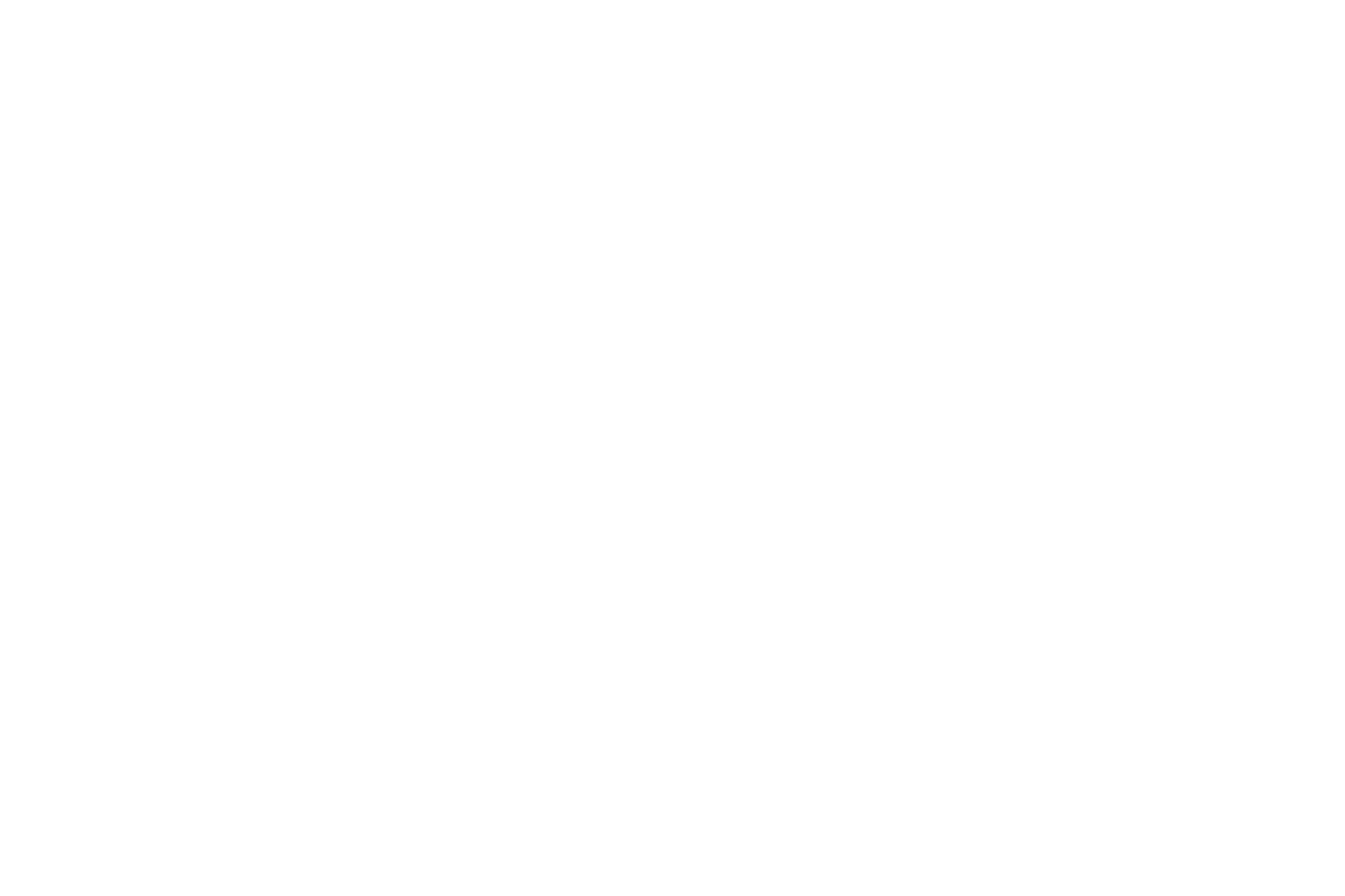
© Iko Freese / drama-berlin.de
Nun ist die Sängerbesetzung hier sehr vielgestaltig, was gilt es zu berücksichtigen?
Koen Schoots Es ist sehr wichtig, dass die Aussage eines Songs oder einer Arie auch im Klang der Stimme zu hören ist. Perchik singt anders als Tevje. Golde singt anders als Hodel oder Zeitel. Diese Generationsunterschiede müssen auch stimmlich hörbar sein. Sogar zwischen Mottel und Perchik will ich einen Unterschied hören. Mottel, der verträumte Schneider, der sich bei »Wunder, oh Wunder« eher in so einen My-fair-Lady-ähnlichen Freddy-Überschwang hineinsingt. Perchik dagegen ist ein Analytiker, ein Kommunist, und dementsprechend singt er auch anders sein »Jetzt hab’ ich, was ich will«. Mit den Sängerinnen der Töchter, die bei uns allesamt ausgebildete Opernstimmen besitzen, arbeite ich daran, dass wir nicht in den Ton einer Operette verfallen. Was bei einer Nummer wie »Matchmaker« (»Jente, oh, Jente«) die große Gefahr ist. Die Betonung lege ich auf weniger Vibrato, dafür legen wir besonderes Augenmerk auf Konsonanten und Textverständlichkeit.
Gibt es Besonderheiten in der Orchesterbesetzung?
Koen Schoots Ja, auch die würde ich als »klassisch« bezeichnen. Einziges Sonderinstrument ist das Akkordeon, das durchgehend spielt. Und man braucht sehr gute Klarinettisten, weil die neben der klassischen Orchesterklarinette auch solistisch in eher freierer Gestaltung eine Art Klezmer-Sound erzeugen müssen. Da ist der Dirigent auf die Initiative und Gestaltungslust der Musiker angewiesen, denn vorschreiben kann man diese Spielweise nicht, nur zusammen erarbeiten.
Anatevka folgt in seiner musikalischen Entwicklung einer ganz merkwürdigen Logik …
Koen Schoots Ja, erstaunlich wie das Gespräch zwischen Lazar Wolf und Tevje über die Heiratsfrage zu »L’Chaim« führt. Das artet regelrecht aus, in einen kollektiven Tanz unter Beteiligung aller anderen Männer. Auch die Hochzeitstänze nehmen großen Raum ein. Das ist aber ganz bewusst so gesetzt: Im ersten Teil des Stücks wird diese Lebensfreude etabliert, um dann im zweiten Teil umso wirkungsvoller den Zusammenbruch zu zeigen. Da gibt es dann keine Tanznummern mehr, sondern es wird ein Kammerspiel daraus, das sehr melodramatisch endet. Die Tänze sind Ausdruck des Lebensgefühls und der Lebensfreude der Bewohner von Anatevka. Das bekommt eine Allgemeingültigkeit, weit über ein jüdisches Schtetl hinaus. Es geht um Geborgenheit. Und diese Welt wird durch Einflüsse von außen kaputt gemacht. Ob dieser Ort nun Anatevka heißt oder Aleppo, ob das vor hundert Jahren in Russland, oder vor 20 Jahren in Bosnien passiert, ist nicht so wichtig. Ich glaube, da liegt die eigentliche Aussage des Stückes.
Koen Schoots Es ist sehr wichtig, dass die Aussage eines Songs oder einer Arie auch im Klang der Stimme zu hören ist. Perchik singt anders als Tevje. Golde singt anders als Hodel oder Zeitel. Diese Generationsunterschiede müssen auch stimmlich hörbar sein. Sogar zwischen Mottel und Perchik will ich einen Unterschied hören. Mottel, der verträumte Schneider, der sich bei »Wunder, oh Wunder« eher in so einen My-fair-Lady-ähnlichen Freddy-Überschwang hineinsingt. Perchik dagegen ist ein Analytiker, ein Kommunist, und dementsprechend singt er auch anders sein »Jetzt hab’ ich, was ich will«. Mit den Sängerinnen der Töchter, die bei uns allesamt ausgebildete Opernstimmen besitzen, arbeite ich daran, dass wir nicht in den Ton einer Operette verfallen. Was bei einer Nummer wie »Matchmaker« (»Jente, oh, Jente«) die große Gefahr ist. Die Betonung lege ich auf weniger Vibrato, dafür legen wir besonderes Augenmerk auf Konsonanten und Textverständlichkeit.
Gibt es Besonderheiten in der Orchesterbesetzung?
Koen Schoots Ja, auch die würde ich als »klassisch« bezeichnen. Einziges Sonderinstrument ist das Akkordeon, das durchgehend spielt. Und man braucht sehr gute Klarinettisten, weil die neben der klassischen Orchesterklarinette auch solistisch in eher freierer Gestaltung eine Art Klezmer-Sound erzeugen müssen. Da ist der Dirigent auf die Initiative und Gestaltungslust der Musiker angewiesen, denn vorschreiben kann man diese Spielweise nicht, nur zusammen erarbeiten.
Anatevka folgt in seiner musikalischen Entwicklung einer ganz merkwürdigen Logik …
Koen Schoots Ja, erstaunlich wie das Gespräch zwischen Lazar Wolf und Tevje über die Heiratsfrage zu »L’Chaim« führt. Das artet regelrecht aus, in einen kollektiven Tanz unter Beteiligung aller anderen Männer. Auch die Hochzeitstänze nehmen großen Raum ein. Das ist aber ganz bewusst so gesetzt: Im ersten Teil des Stücks wird diese Lebensfreude etabliert, um dann im zweiten Teil umso wirkungsvoller den Zusammenbruch zu zeigen. Da gibt es dann keine Tanznummern mehr, sondern es wird ein Kammerspiel daraus, das sehr melodramatisch endet. Die Tänze sind Ausdruck des Lebensgefühls und der Lebensfreude der Bewohner von Anatevka. Das bekommt eine Allgemeingültigkeit, weit über ein jüdisches Schtetl hinaus. Es geht um Geborgenheit. Und diese Welt wird durch Einflüsse von außen kaputt gemacht. Ob dieser Ort nun Anatevka heißt oder Aleppo, ob das vor hundert Jahren in Russland, oder vor 20 Jahren in Bosnien passiert, ist nicht so wichtig. Ich glaube, da liegt die eigentliche Aussage des Stückes.
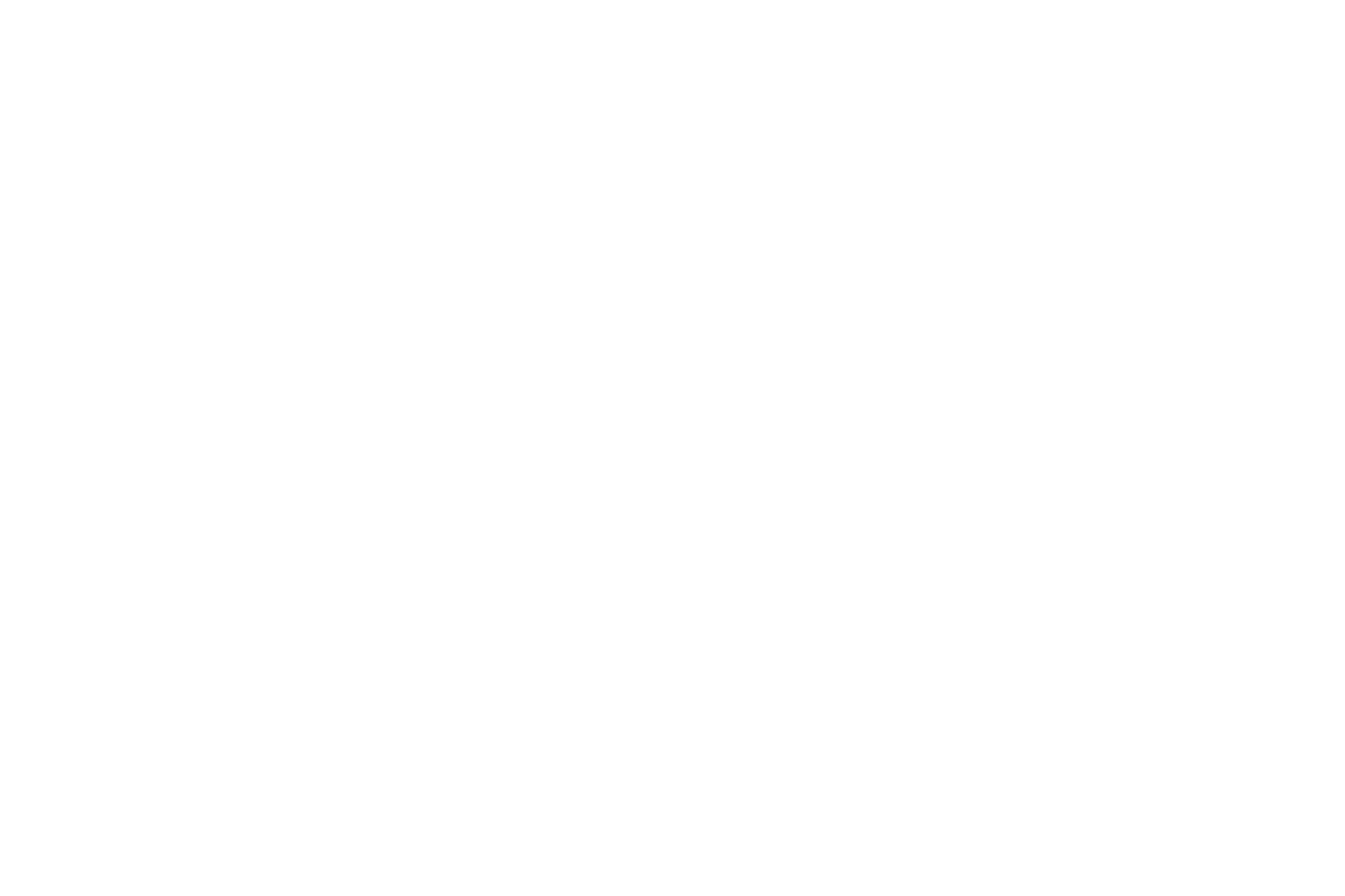
© Iko Freese / drama-berlin.de
Hinzu kommt die Frage der Tradition ...
Koen Schoots Das zweite große Handlungsmotiv dieses Stücks: Neben dem Zusammenbrechen einer kleinen Gemeinschaft wird auch vom Fortschritt erzählt, den man nicht aufhalten kann und der von vielen Leuten als beängstigend empfunden wird – und mitunter sehr radikale und auch brutale Reaktionen erzeugt, man vergleiche das nur mit den jüngsten Wahlergebnissen.
Muss man bei Anatevka eine besondere Balance zwischen Gefühl und Sentiment halten?
Koen Schoots Das muss man immer, aber ich teile nicht die landläufige Verachtung, die viele gegen die Gattung Musical hegen. Musiktheater lebt in jeder Ausprägung von Überhöhung und Übertreibung. Man kann Mozarts Zauberflöte ketzerisch als das erste Musical bezeichnen. Das Stück ist doch ein einziges Potpourri! Das Genre Musical ist sehr vielfältig: Von der Leidensgeschichte Jesu als Rockoper über Priscilla, Queen of the Desert (2006) und Kinky Boots (2012) bis hin zu The Producers (2001), wo über Hitler gelacht wird. Musical oder das Musiktheater funktionieren dann, wenn ich die Leute berühren kann, gleich ob mit Humor oder mit Gefühl.
Woher rührt – historisch gesehen – der Erfolg der Gattung?
Koen Schoots Das hat mit dem Auszug der Juden aus Europa, aus Deutschland und aus Russland im 19. und 20. Jahrhundert zu tun. Es hat sie nach New York verschlagen und dort wurde fortgesetzt, was hier begonnen wurde. In Amerika lebt nach wie vor genug Freigeist und liberales Denken, dass Stücke wie Hamilton (2015), über den amerikanischen Gründervater, funktionieren. In unseren Kreisen, in Deutschland und in Österreich, und zum Teil auch in Holland, werden Musicals leider sehr herablassend behandelt. Die New York Times schreibt über jede Musicalpremiere am Broadway. Man schickt die besten Kritiker und betrachtet das Musical als vollwertige Kunstform, während man in Europa immer leicht die Nase rümpft. Ich behaupte mal ganz provokant, dass diese Haltung eine große Nähe zu jener Verachtung hat, die im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts die jüdischen Künstler in die Emigration zwang.
Hat Anatevka eine besondere Rolle für die Popularisierung der Kunstgattung gespielt?
Koen Schoots Anatevka ist ein Kind seiner Zeit, in jenen Jahren war der Broadway – wie übrigens auch heute – in einer sehr kreativen Phase, das war eine Hochzeit. Nach den leichten Revuen der 20er-Jahre hatte man sich ernsten Themen zugewandt und sah Musicals nicht mehr als oberflächliche Unterhaltung an – es entstanden geradezu »Literatur-Musicals«. Diese Entwicklung hatte früh begonnen: Mit South Pacific (1958), Show Boat (1927) und West Side Story (1957) spielte man Musicals, in denen Krieg und Rassismus thematisiert wurden. Auch in Anatevka wird ein Rassenkonflikt gezeigt und zugleich sind diese Werke großartige Theaterstücke – sie verbinden ernsthafte Themen mit anspruchsvoller Unterhaltung auf hohem künstlerischen Niveau.
Koen Schoots Das zweite große Handlungsmotiv dieses Stücks: Neben dem Zusammenbrechen einer kleinen Gemeinschaft wird auch vom Fortschritt erzählt, den man nicht aufhalten kann und der von vielen Leuten als beängstigend empfunden wird – und mitunter sehr radikale und auch brutale Reaktionen erzeugt, man vergleiche das nur mit den jüngsten Wahlergebnissen.
Muss man bei Anatevka eine besondere Balance zwischen Gefühl und Sentiment halten?
Koen Schoots Das muss man immer, aber ich teile nicht die landläufige Verachtung, die viele gegen die Gattung Musical hegen. Musiktheater lebt in jeder Ausprägung von Überhöhung und Übertreibung. Man kann Mozarts Zauberflöte ketzerisch als das erste Musical bezeichnen. Das Stück ist doch ein einziges Potpourri! Das Genre Musical ist sehr vielfältig: Von der Leidensgeschichte Jesu als Rockoper über Priscilla, Queen of the Desert (2006) und Kinky Boots (2012) bis hin zu The Producers (2001), wo über Hitler gelacht wird. Musical oder das Musiktheater funktionieren dann, wenn ich die Leute berühren kann, gleich ob mit Humor oder mit Gefühl.
Woher rührt – historisch gesehen – der Erfolg der Gattung?
Koen Schoots Das hat mit dem Auszug der Juden aus Europa, aus Deutschland und aus Russland im 19. und 20. Jahrhundert zu tun. Es hat sie nach New York verschlagen und dort wurde fortgesetzt, was hier begonnen wurde. In Amerika lebt nach wie vor genug Freigeist und liberales Denken, dass Stücke wie Hamilton (2015), über den amerikanischen Gründervater, funktionieren. In unseren Kreisen, in Deutschland und in Österreich, und zum Teil auch in Holland, werden Musicals leider sehr herablassend behandelt. Die New York Times schreibt über jede Musicalpremiere am Broadway. Man schickt die besten Kritiker und betrachtet das Musical als vollwertige Kunstform, während man in Europa immer leicht die Nase rümpft. Ich behaupte mal ganz provokant, dass diese Haltung eine große Nähe zu jener Verachtung hat, die im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts die jüdischen Künstler in die Emigration zwang.
Hat Anatevka eine besondere Rolle für die Popularisierung der Kunstgattung gespielt?
Koen Schoots Anatevka ist ein Kind seiner Zeit, in jenen Jahren war der Broadway – wie übrigens auch heute – in einer sehr kreativen Phase, das war eine Hochzeit. Nach den leichten Revuen der 20er-Jahre hatte man sich ernsten Themen zugewandt und sah Musicals nicht mehr als oberflächliche Unterhaltung an – es entstanden geradezu »Literatur-Musicals«. Diese Entwicklung hatte früh begonnen: Mit South Pacific (1958), Show Boat (1927) und West Side Story (1957) spielte man Musicals, in denen Krieg und Rassismus thematisiert wurden. Auch in Anatevka wird ein Rassenkonflikt gezeigt und zugleich sind diese Werke großartige Theaterstücke – sie verbinden ernsthafte Themen mit anspruchsvoller Unterhaltung auf hohem künstlerischen Niveau.
Mehr dazu
12. März 2025
Menschliche Kaleidoskope
In Barrie Koskys Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny gibt es kein Entkommen: Jeder sieht sich selbst – vervielfacht, verzerrt, gefangen im eigenen Spiegelbild. Zwischen Gier, Macht und Untergang entfaltet sich eine Welt, in der alles erlaubt und der Absturz garantiert ist. In Mahagonny vereinen sich Brechts so schneidender Blick auf die Gesellschaft und Weills grandios-mitreissende Musik zu einem schmerzhaften und aktuellen Blick auf Narzissmus – und auf eine Gesellschaft, die ihren Gemeinsinn verliert. In ganz realen Spiegeln auf der sonst kargen Bühne entfaltet Barrie Kosky die Oper zu einem Kaleidoskop menschlicher Absurdität und fragt: Was bleibt von uns, wenn wir uns selbst nicht mehr erkennen? Ein Gespräch über die Bibel, Selfies und den Sündenbock in seiner Inszenierung.
#KOBMahagonny
Interview
20. März 2024
Wo ein Wille ist
Regisseur Barrie Kosky und Dirigent Adam Benzwi im Gespräch über Schutzengel, Wiener Wohnzimmer, eiskalten Martini und ihre Inzenenierung Eine Frau, die weiss, was sie will!
#KOBEineFrau
Interview
6. März 2024
Spielwut von Knast bis Klapse
Dagmar Manzel und Max Hopp über Tempo, Sandkästen und die Schauspielerei in Eine Frau, die weiß, was sie will.
#KOBEineFrau